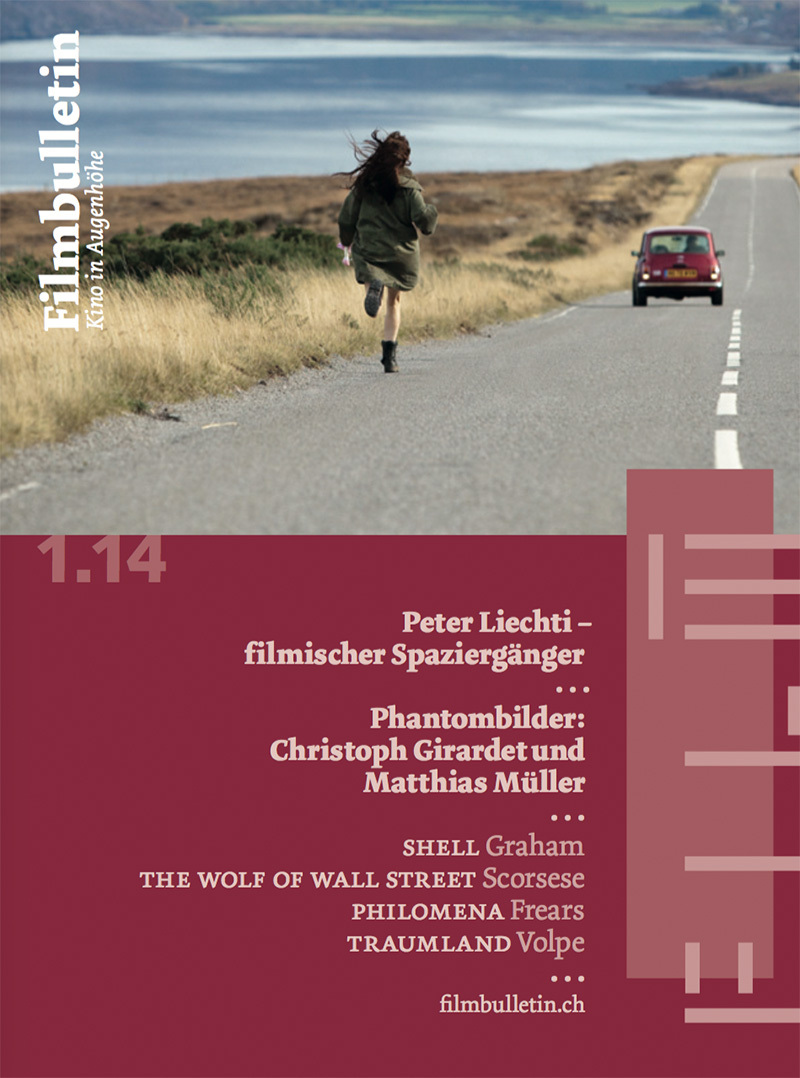«Eine relativ ausdruckslose Grossaufnahme des aus dem Bild blickenden Schauspielers Ivan Mozzhuchin wird nacheinander mit Einstellungen einer Toten im Sarg, eines Tellers Suppe und eines Kindes kombiniert, woraufhin das Testpublikum angab, in Mozzhuchins Gesichtsausdruck Trauer, Hunger oder väterliche Zärtlichkeit zu erkennen.» So wird in «Reclams Sachlexikon des Films» jenes Experiment beschrieben, das der russische Avantgardefilmemacher Lew Wladimirowitsch Kuleschow in den zwanziger Jahren mit Testzuschauern angestellt haben soll und das unter dem Namen «Kuleschow-Effekt» Theoriegeschichte gemacht hat. Auch wenn mitunter bezweifelt wird, dass jenes Experiment tatsächlich in dieser Form stattgefunden hat, sein Befund findet sich doch in jedem Film bestätigt: Eine einzelne Aufnahme ist nicht aussagekräftig in und für sich selbst, sondern ihr wächst erst durch die Kombination und Gegenüberstellung mit anderen Aufnahmen Bedeutung zu.
Differenz, maximal und minimal
Damit bestätigt der Kuleschow-Effekt für den Film freilich nur, was Ferdinand de Saussure ohnehin als Grundprinzip jeglicher Semiotik behauptet. Auch in der Sprache gebe es nichts als Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder, so der Genfer Linguist in seinen «Vorlesungen zur allgemeinen Sprachwissenschaft». So wie sich im sprachlichen System jedes Zeichen erst dadurch definiert, wie es sich von den anderen Zeichen abhebt, so funktioniert auch die filmische Syntax über die mehr oder weniger ausgeprägten Differenzen zwischen den einzelnen Einstellungen.
Gilt diese Gleichung einer Bedeutungsproduktion durch Differenz für den Film per se, so zeigt sie sich doch selten so eindrücklich wie in den radikalen Werken des Künstlerduos Christoph Girardet und Matthias Müller, das in seinen Filmcollagen die Prinzipien der filmischen Syntax bis zum Extrem ausreizt, wenn es Bilder und Szenen aus ganz unterschiedlichen Quellen auf völlig unvorhergesehene Art zusammenfügt. Vor allem ist es der reiche Fundus der Filmgeschichte, aus dem die Künstler ihr Material nehmen. Found Footage nennt man dieses Genre des Experimentalfilms, in dem einzelne Bilder, Szenen und Sequenzen aus einem fremden Filmkorpus herausgebrochen und neu zusammengefügt werden. Dabei sind die Fugen zwischen den Einzelteilen immer von besonderer Relevanz. Mal ist der Sprung von einem Bild zum andern maximal, wie in cut, wo die Künstler an einer Stelle von der Rinde eines Baumes, über die Ameisen krabbeln, direkt auf die Nahaufnahme von schweissbedeckter Haut umschneiden. Dann wieder ist die Lücke zwischen den Bildern infinitesimal winzig, wie in Necrologue (einem Teil der Phoenix Tapes), in jenem kurzen Moment aus Hitchcocks Under Capricorn, in dem eine traumatisierte und zu Tode erschöpfte Ingrid Bergman aus ihrem Schlummer erwacht und ihre Augen aufschlägt. Girardet und Müller zerdehnen diesen buchstäblichen Augenblick zu einer mehrere Minuten dauernden Zeitlupe, in der jede noch so feine Regung der Augenlider und die kleinste Bewegung der hinter ihnen verborgenen Augen wahrnehmbar wird. Selbst den ruhigen Fluss des Blutes unter der Haut glaubt man erspüren zu können, vor allem aber wird jener andere Puls sichtbar, der Puls des Mediums selbst. In der Super-Zeitlupe sieht man das sanfte Pochen des Filmkorns und das unmerkliche Schwanken der Technicolorfarben zwischen den unendlich vielen Farbschattierungen des Gesichts, des Haars, des Kissens und der Dunkelheit im Hintergrund. Im scheinbar kleinsten Abstand zwischen zwei Bildern tut sich ein regelrechtes Universum von Nuancen auf. Die mikroskopische Lücke zwischen den Bildern ist hochgradig potenziert und überdeterminiert.

Fortsetzung des Melodrams mit experimentellen Mitteln
In einem Gespräch mit Isabella Rossellini, der Schauspielerin und Tochter Ingrid Bergmans, erwähnt der Regisseur Guy Maddin diesen Film von Girardet und Müller, um dabei betroffen festzustellen, dass deren Filmexperiment offenbar akkurat jenen Zustand der Erschöpfung am Rande des Todes abbildet, von dem auch Isabella Rossellini berichtet, wenn sie ihre Erinnerungen an die schwer krebskranke Mutter schildert. So entpuppt sich das scheinbar ganz und gar abstrakte Experiment von Necrologue als ebenso bewegendes wie akkurates Porträt einer Leidenden, viel erschütternder noch als Hitchcocks Kostümdrama, aus dem die hier zelebrierte Szene stammt.
Die Filme von Girardet und Müller sind nicht nur kühl beobachtete Versuchsanordnungen, sondern entfalten in ihrer Präzision eine emotionale Wucht, mit der sogar das ungleich offensichtlicher auf Empathie ausgerichtete Erzählkino nicht mithalten kann. Abstraktion und Gefühlsaufwallung sind kein Widerspruch, sondern bedingen sich gegenseitig. Das mag denn auch die anhaltende Obsession der beiden Künstler für das Genre des Melodrams erklären. Denn auch die Melodramen des klassischen Hollywoodkinos bestechen gerade dadurch, dass sie unentwegt übersteigerte Künstlichkeit mit übersteigerter Emotionalität zu koppeln wissen. Nichts ist so fadenscheinig artifiziell wie ein Melodram und rührt trotzdem oder gerade deswegen das Publikum zu Tränen. Dieses komplexe Verhältnis von Täuschung und Gefühl verdichtet sich denn auch im Objekt des Spiegels, dessen leitmotivische Funktion in den Melodramen von Douglas Sirk bereits verschiedentlich beschrieben wurde, der aber auch sonst gleichsam emblematisch für die selbstreflexive Bildlogik des Melodrams steht.
Girardet und Müller radikalisieren diese Spiegelmetapher des Melodrams in ihrem überwältigenden Kristall und dessen klirrendem Reigen unzähliger Spiegelszenen. So wie sich im Vorspann von Sirks Imitation of Life (der ja bereits im Titel auf den Spiegel anspielt) die Leinwand allmählich mit herunterrieselnden Gemmen füllt, so stossen im Film von Girardet und Müller Filmscherben, zersplitterte Kinomomente funkelnd aneinander. Da legt Robert Taylor in Party Girl seiner Cyd Charisse vor dem Spiegel ein Juwelenhalsband um, dort schlägt Anthony Quinn in Portrait in Black Lana Turners Konterfei aus dem Spiegel, Spencer Tracy versucht, sich im Glas wiederzuerkennen, Barbara Steele senkt vor sich selbst den Blick. Was die Filme, aus denen die Künstler ihre Edelsteine geraubt haben, über ihre gesamte Laufzeit hinweg entwickeln, komprimieren Girardet und Müller auf wenige Augenblicke. Auch Diamanten sind bekanntlich nichts anderes als unter besonderem Druck verdichtete Kohle. Die Kristallbilder Girardets und Müllers funktionieren nicht anders. Während man im bereits erwähnten Party Girl von Nicholas Ray erst allmählich und nur vage begreift, wie sich dieser Film um das Wechselverhältnis von weiblicher Inszenierung und männlicher Impotenz dreht, wird einem das in der Bearbeitung von Girardet und Müller schlagartig bewusst. Die fremden Filmbilder werden von den beiden Künstlern so umgeschliffen, dass das unheimliche Schillern von Frustration und Befriedigung, Lust, Angst, Gewalt, Versagen und Melancholie zugleich abstrakter und doch unvermittelter aufscheint. Doch nicht nur, dass wir sehen, wie die Figuren betört, verwirrt und hypnotisiert sind von den Glitzerdingen um sie herum, Girardet und Müller haben die Bilder aus den Filmen ihrerseits durch Scherben und Kristalle hindurch umkopiert, sodass sich die zitierten Szenen verfremden, die Körper verdoppeln und die Gesichter verziehen. Die in den Szenen dargestellten Spiegelungen erobern die Darstellung selbst. Das Vexierspiel greift vom Inhalt auf die Form über und totalisiert sich dadurch. Das Kunstwerk wird zur Fortsetzung und Vollendung des Melodramas mit experimentelleren Mitteln.
Der Kuleschow-Affekt
Man wird diesen Werken aber nicht gerecht, wenn man sie nur als Apotheose einer bereits vertrauten Kinoerfahrung liest. So nah sich diese Kunstwerke auch an die Gefühlslage jener Filme anlehnen, aus denen sie sich bedient haben, und so bewegend Guy Maddins Beobachtung sein mag, dass ein Film wie Necrologue die tatsächliche Erfahrung am Sterbebett reproduziert – Girardet und Müller gehen immer noch weiter. Sie zapfen die im fremden Filmmaterial gespeicherte Emotionalität an, doch nur, um über diese hinauszugehen und Eindrücke zu schaffen, die man so noch nirgends erlebt hat. Das ist ja auch das, was an der eingangs zitierten Beschreibung des Kuleschow-Effekts zu unbefriedigend bleibt. Wenn es dort heisst, die Testzuschauer hätten dank der Kombination mit anderen Bildern in der ausdruckslosen Grossaufnahme des Schauspielergesichts nun «Trauer, Hunger oder väterliche Zärtlichkeit» entdeckt, scheint dies allzu banal. Ist es nicht eher so, dass die Bildverkettung in den Bildern neue Emotionen entdecken liess, die man gar nicht so recht zu fassen wusste? Statt einfach ein bereits bekanntes Gefühl abzubilden, kreiert die Bildkombinatorik von Kuleschow vielmehr neue Emotionen: Auf der Leinwand entsteht ein neuer, vorher nicht bekannter Zustand, weniger Kuleschow-Effekt als vielmehr Kuleschow-Affekt (ein Neologismus, den offenbar auch der Potsdamer Medienwissenschaftler Jörg Sternagel bereits verwendet hat, wenn auch mit anderem Interesse).
Kuleschow-Affekt – das ist auch das, was Sergej Eisenstein meint, wenn er in seiner berühmten Replik an Béla Balázs von der Schere als «Produktionsmittel» schreibt. Der Schnitt, die Montage, das Kombinieren disparater Bilder erschöpft sich nicht in der schieren Reproduktion des bereits Vorhandenen, sondern ist eigenständige Produktion, schafft Neues. In den Found-Footage-Filmen von Christoph Girardet und Matthias Müller zeigt sich diese Produktivität, die allein vom Schnitt herrührt, in reinster Form, denn die einzelnen Bilder, ihre Inhalte und Einstellungen existierten bereits, die Künstler fügen als neues Element zuweilen einzig den Schnitt hinzu. Doch dieser verändert alles.
In Manual schneiden Girardet und Müller die Bilder einer Hand auf nackter Haut zusammen mit den Bildern von einer andern Hand, die eine silberne Kunststoffmatratze knetet. Aber die Schnitte folgen so rasend schnell aufeinander, dass sich in den trägen Augen des Betrachters die Massage des Körpers mit der Massage des Kunststoffs vermischt. Fleisch und Plastik verschmelzen – ein Anblick, der den Zuschauer bis in die Eingeweide erschüttert und eine besondere Form der Übelkeit hervorruft, die sich gar nicht beschreiben lässt. Der Zuschauer wird von einem Kuleschow-Affekt ergriffen, für den es kein Pendant und darum auch kein Vokabular jenseits dieses Films gibt.
Gilles Deleuze schreibt von der Farbe im Film, sie symbolisiere nicht Affekte (Rot für die Liebe, Grün für die Hoffnung), vielmehr sei die Filmfarbe selbst schon Affekt, ein neuer Gefühlszustand, unübersetzbar in irgendein anderes Medium. Dasselbe gilt samt und sonders für die Schnitte in den Filmen von Girardet und Müller: Auch sie symbolisieren nicht, sondern schaffen selber neue, rätselhafte Affekte. In Cut, einem Film, den sie eigens für die grosse Werkschau im Kunstverein Hannover gemacht haben und der nicht umsonst den Schnitt schon im Titel trägt, schneiden sie Körperbilder mit Naturaufnahmen, Anorganisches mit Organischem zusammen, sodass sich daraus eine körperliche Erfahrung ergibt, die ihresgleichen sucht: Wassertropfen, die auf Blüten fallen, assoziieren sich mit der tropfenden Medizin der Infusion, mit den Blutstropfen, die aus Wunden rinnen, und diese wiederum setzen sich fort im Wasser, das in Dario Argentos Profondo rosso aus dem Mund der Hellseherin stürzt. Die Adern im Röntgenbild der kleinen Regan aus The Exorcist finden ihre Analogie in den verkrüppelten Ästen, die sich in Mario Bavas Maschera del demonio vor dem Gewitterhimmel abzeichnen. Und wenn die wahnsinnige Nonne aus Michael Powells Black Narcissus aus ihrer Ohnmacht wieder zu sich kommt, setzt sich ihr Augenaufschlag fort in jener spöttisch hochgezogenen Augenbraue von Dana Wynter aus Invasion of the Body Snatchers, wenn sie sich als Besessene zu erkennen gibt.
So verbinden sich die verschiedenen Gestalten und Objekte zu einem neuartigen, von rätselhaften Affekten beseelten Wesen. Die am Schneidetisch von Girardet und Müller entstehenden Körper haben ihre scharfen Konturen verloren und werden stattdessen zu dem, was Deleuze «organlose Körper» nennt – dezentrierte Leiber, die ihre Organisation abgestreift haben und stattdessen zu «Zonen der Ununterscheidbarkeit» werden, wo sich verschiedene Personen vermischen und wo technische Gerätschaft in Körperglieder übergeht und umgekehrt: Auf das Bild einer wütend unter die Haut geschobenen Kanüle antwortet die Grossaufnahme eines weitgeöffneten Mundes, aus dem der Atem rasselt. Die Haut ist auch ein Strumpf, den man zerreisst, der Teppich auch eine Epidermis, die blutet. Haar ist Schilf und die Kissenfüllung Eingeweide. Ein gänzlich neues Körpergefühl ereignet sich in Bildern und überträgt sich auf den sprachlosen Zuschauer, dem nichts übrig bleibt, als sich überwältigen zu lassen von Affekten, die er nicht kennt. «Tell me what you see!» heisst es in Contre-jour, und mit gutem Grund ist dies auch der Titel der Werkschau in Hannover. Eine Aufforderung von höchster Ironie – denn genau daran, übersetzen zu wollen, was sich da vor unseren Augen ereignet, scheitern wir. Die neuen Schnittaffekte lassen sich sehen und erleben, aber nicht beschreiben.

Was sehen wir?
Doch selbst dieses Sehen ist instabil. So wie die neuen Affekte an den Grenzen, den prekären Schnittstellen zwischen den Aufnahmen, zwischen menschlichen, tierischen, pflanzlichen und technischen Körpern sich ereignen, so ist auch die Wahrnehmung dieser Affekte eine prekäre, fragile. Als 2001, an den fünften Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur, spät nachts die Kurzfilme von Matthias Müller gezeigt wurden, ging die Lampe des Filmprojektors kaputt, und die Ersatzbirne, die man schliesslich auftrieb, erwies sich als zu schwach. Müllers Filme waren nur schimmernd und schummrig zu sehen: ein Ärgernis für den anwesenden Filmemacher genauso wie für uns, die wir zum ersten Mal diese Filme sehen wollten und nun nur beinahe zu sehen bekamen. Und doch erweist sich rückblickend gerade der Defekt des Vorführapparats als überraschend passend, gleichsam als die Vorwegnahme jenes Films, den Matthias Müller zusammen mit Christoph Girardet Jahre später unter dem Titel Contre-jour machen wird. Das Flickern und Flackern der Projektion, das damals so störte, ist in Contre-jour intendierte Verfremdung. Die unzähligen Filmausschnitte von sich öffnenden Lidern, sich erweiternden Pupillen, Ärzten, die ihre Stirnreflektoren richten und ihren Patienten in die Augen leuchten, werden in blossen Flashes gezeigt, als zittrige Lichtbilder, die nur kurz auflodern und wieder verlöschen. Dazwischengeschaltet ist selbst gedrehtes Material: Porträtaufnahmen von Menschen, deren dunkle Silhouetten allmählich erleuchtet werden, Ihre Gesichter werden erhellt, bis sie sich geblendet abwenden und die Hände schützend vors Gesicht halten. Sie sind Doubles von uns Zuschauern, die wir diesen Film und seine knisternden Aufnahmen nur mit zugekniffenen Augen anzuschauen vermögen. Zweifellos sind die Augenärzte, die an den Sehwerkzeugen ihrer Patienten herumhantieren, auch Stand-ins für die beiden Regisseure, diese mad scientists, die an ihrem Lichtpult wie auf einem Seziertisch Filme auseinander- und neu zusammenschneiden. Ihre Operationen am geöffneten Korpus der Filmgeschichte sind auch Operationen am offenen Auge des Zuschauers. So wie die neuen Affekte durch neue Sichtweisen bedingt sind, so wird, wer sich einmal den optischen Operationen von Girardet und Müller unterzogen hat, Filme nicht mehr sehen können wie zuvor.
Verätzte Augen, Röntgenblick, Fetischismus
«Tell me what you see!» – das liesse sich indes auch als Aufforderung an den Cinephilen verstehen, die ausgeliehenen Filmschnipsel zu identifizieren. Zerrissen vom Zwang, die Augen vor diesem Lichtgewitter in Contre-jour zu verschliessen, und unserer Lust, noch genauer hinzuschauen, gucken wir durch die Finger hindurch und erblicken das sich öffnende Auge aus der Eröffnungssequenz von Michael Powells Peeping Tom, das todesstarre Auge Janet Leighs aus Psycho, erkennen, dass am Operationstisch Alida Valli aus Les yeux sans visage steht und Ingrid Bergman aus Spellbound. Wir versuchen, uns alles einzuprägen, bis wir die schmerzenden Augen abwenden müssen, so wie der schreiende Ray Milland, der in Roger Cormans The Man with The X-Ray Eyes es nicht mehr aushält, unentwegt alles sehen zu müssen.
Cinephilie – das wird einem bei Girardet und Müller klar – ist eine Art Röntgenblick, der durch die Filme hindurchdringt, sie auf der Suche nach jenen Momenten, die des Bewahrens wert sind, zerteilt und zersetzt. So wie in der ersten Einstellung von Contre-jour zischende Säure ins Objektiv und damit auch ins Zuschauerauge tropft, so brennen sich für den Kinobesessenen einzelne Momente der Filmgeschichte in seine Netzhaut und Erinnerung ein. Das erlaubt ihm, noch in den obskursten Filmen Augenblicke des Erhabenen zu erhaschen. Gerade mal zwei Sekunden dauert jener Moment aus dem deutschen B-Movie Der Unsichtbare, in dem eine mit Fotokamera bewaffnete Ellen Schwiers in die Kamera starrt. Doch Christoph Girardet dehnt in Delay diesen Moment zur dreieinhalbminütigen Szene und verstärkt damit jene Hypnose, die zuvor nur der obsessive Künstler in diesem flüchtigen Moment verspürt hatte. Das entlarvt denn auch den Begriff «Found Footage», den man für diese Filme anwendet, als eigentlich irreführend. Die Rede vom «gefundenen Material» impliziert, dass einem diese Funde einfach zufällig zufielen. Tatsächlich aber steckt hinter den Filmen von Christoph Girardet und Matthias Müller eine aufwendige archäologische Recherche, die auch als solche ausgewiesen wird, etwa wenn sie im Abspann die verwendeten Filme auflisten. In Phoenix Tapes schliesslich haben sich Girardet und Müller jenem Œuvre angenommen, das wohl wie kein anderes die Augenlust der Cinephilen bis heute anstachelt. In sechs Kapiteln und während insgesamt über fünfundvierzig Minuten durchforsten die Künstler die Filme Hitchcocks, deren Bild- und Tonspuren, deren Plätze und Objekte, Gesichter, Zeichen, Hände, Gesten, Farben und Klänge. Doch anders als das Internetprojekt «1000 Frames of Hitchcock», in dem jeder Hitchcock-Film in tausend Screenshots zusammengefasst ist, wird hier keine Übersicht, sondern vielmehr eine röntgenartige Durchsicht von Hitchcocks Werk versucht, in der sich visuelle Obsessionen und fixe Ideen des Masters of Suspense herauskristallisieren: die Hände etwa, die nach den Dingen greifen, den Waffen, Zetteln, Ringen, Schlüsseln, Knäufen, Knöpfen, Kordeln, Tasten, Schaltern, und sich dann ballen, zittern und zucken, frustriert ob der Vergeblichkeit all dieser Gesten. Oder all die hilflosen, hoffnungslosen, haltlosen, lustlosen Männer, die mit ihren Müttern reden, sie anflehen, anfahren, anbeten, anklagen, ihre müden, matten, gelangweilten, grimmigen, gierigen, grausigen, grinsenden, lästernden, lachenden Mütter.
Ein Kabinett der Pathologien entsteht so. Zugleich aber wird die Cinephilie als eine solche erkannt. Indem der Cinephile Filme in Lieblingsszenen zerstückelt, ähnelt er den Mördern und Chirurgen, die mit ihren Messern und Skalpellen Körper auf- und zerschneiden. Der lebende, laufende Film muss gestoppt, unterbrochen, zerteilt und abgetötet werden, damit man ihm seine Einzelbilder und Einzelszenen entreissen kann. Das ist es, was der Cinephile in seiner Erinnerung mit den geliebten Filmen anstellt. Girardet und Müller führen nur auf dem Schneidetisch aus, was wir in unseren Köpfen unentwegt tun. Die Lust am Kino erweist sich als Fetischismus, der sich an Partialobjekten, an einzelnen Szenen aufgeilt und dabei gar nicht mehr interessiert ist am Film als einem Ganzen. In Kristall gibt es eine Sequenz, in der ein leeres Schlafzimmer in einem Spiegel reflektiert wird, vor dem Spiegel aber hängt eine Schmuckkette. Wie sich die Kamera bewegt, verändert sich der Lichteinfall, und plötzlich erscheint ein Reflex auf einem der Edelsteine der Kette, ein Leuchten, ein Glanz trifft das Auge. Es ist ein wunderbarer Moment, buchstäblich eine Epiphanie und zugleich exemplarischer Fall des hier zelebrierten Fetischismus. Der Glanz auf der Kette erinnert an jenen besonderen «Glanz auf der Nase», von dem einer von Freuds Patienten so besessen war und mit dessen Fall Freud seinen Aufsatz «Fetischismus» von 1927 eröffnet. Als Freud erfährt, dass sein Patient eine englische Kinderstube gehabt hat, wird ihm klar: «Der aus den ersten Kinderzeiten stammende Fetisch war nicht deutsch, sondern englisch zu lesen, der “Glanz auf der Nase” war eigentlich ein “Blick auf die Nase” (glance = Blick), die Nase war also der Fetisch, dem er übrigens nach seinem Belieben jenes besondere Glanzlicht verlieh, das andere nicht wahrnehmen konnten.» Der Blick, der [glance erschafft den Glanz des Fetisch. Es braucht den besonderen Blick von Christoph Girardet und Matthias Müller, um jenes Glanzlicht im Filmmaterial aufzuspüren, das – wie Freud es formuliert – «andere nicht wahrnehmen konnten». Doch der Blick, der diesen Moment aufgespürt hat, war nie neutral in seiner Akribie. Er ist es vielmehr selbst, der den Glanz erst zum Leuchten bringt. Was wir im Glanz auf der Kette leuchten sehen, ist der Schimmer unseres eigenen fetischistischen Blicks.

Tote Stellen
So zelebrieren die beiden Künstler in einer Art folie à deux diese fetischistische Lust an der filmischen Einzelheit und reflektieren zugleich diese Lust äusserst kritisch und mit grosser Ironie. Denn oft genug sind es gerade die unscheinbaren, die vermeintlich nichtssagenden Filmstellen, auf die es die beiden in ihren Found-Footage-Werken abgesehen haben. Filmverrückte Kinooperateure haben in der Vergangenheit ikonische Momente wie etwa die Kussszenen aus Casablanca aus Filmkopien rausgeschnitten, Girardet und Müller hingegen sind an solch offenkundigen Höhepunkten nicht interessiert. In Scratch hat Christoph Girardet lauter Filmmomente zusammengetragen, in denen sich Schallplatten drehen. Auf der Tonspur ist dazu nur das Knistern der leeren Rille zu hören. Die immer wieder im Loop sich wiederholenden Minisequenzen sind selbst wie eine hakende Platte, die nicht weiterkommt. Eine irr sich drehende Endlosschlaufe, genauso wie der sich aus lauter Aufnahmen von Uhren zusammengesetzte 60 Seconds, wo man zuschauen kann, wie der Sekundenzeiger einmal rundherum und dabei durch sechzig Filme durchgeht. Auch im Gemeinschaftswerk Play sind es solche toten Momente, auf denen Girardet und Müller beharren. Das titelgebende Theaterstück auf der Bühne ist gar nie zu sehen, sondern immer nur verschiedene Zuschauerräume und ein Publikum, das mal ergriffen klatscht, dann frenetisch applaudiert, das aufsteht, sich wieder setzt, auf dem Sitz nach vorne rückt, sich zurücklehnt, das gespannt ist, entrüstet, schockiert, gelangweilt und wartet. Das Verblüffende aber ist, dass aus der Aneinanderreihung solch toter Momente sich ein eigentliches Drama ergibt. Die Vorführung, die das Publikum vor unseren Augen veranstaltet, ist mysteriöser und spannender, als es die Szenen auf der Bühne je sein könnten.
So wie der Glanz der Bilder vom glance des Zuschauerblicks herrührt, so entpuppen sich hier die Betrachter als das, was es eigentlich zu betrachten gilt. Was jenseits der Aufführung, gleichsam im toten Winkel, geschieht, ist das wahrhaft Spannende. Auch in den rätselhaften, diesmal nicht aus fremdem Filmmaterial stammenden, sondern selbst gedrehten Tableaus von Mirror scheint man in jenen Limbus geraten zu sein, der sich zwischen zwei Aktionen auftut. Ein Mann, eine Frau, sie im Cocktailkleid, er in Anzug und Krawatte, stehen verloren in leeren Räumen, warten darauf, dass etwas passiere, oder sinnieren über das nach, was eben geschehen ist. Doch das, was man sieht, ist nur die tote Zeit, der tote Raum dazwischen. Es gibt nichts als diesen Zwischenraum. Anders als in ihren Found-Footage-Arbeiten haben die Künstler hier nicht die eigentlichen Aktionen wegschneiden müssen, um die toten Stellen freizulegen. Sie haben diese eigens inszeniert und nichts als diese. Das Dazwischen ist die einzig vorhandene Attraktion. Allmählich erkennt der Zuschauer beim Betrachten dieses Films, dass sich jeweils in der Mitte der Bilder eine haardünne Line auftut, ein Riss wie eine Spiegelachse. In ihren Collagen lassen Girardet und Müller fremde Bilder neu aneinanderstossen, um so neue KuleschowAffekte zu produzieren. Hier nun ist die Kante, an der sich die Bilder aneinanderreiben, als deren Mittelpunkt und Hauptsache ins Bild hineingesetzt. Extremste Visualisierung eines solchen toten Zwischenreichs schliesslich sind jene Bilder, die gar keine sind: all die vielen Schwarzbilder, mit denen Girardet und Müller ihre Filme immer wieder skandieren. Es sind Pausen, in denen der Atem der Bilder angehalten wird, sich ein schwarzer Abgrund auftut wie einst in der aufbrechenden Erde aus Matthias Müllers frühem Aus der Ferne – The Memo Book oder jenem Riss im Boden aus Sleepy Haven.

In solchen schwarzen Nichtbildern indes wimmeln die Kuleschow-Affekte besonders eifrig. Infolge der Nachbildwirkung klingt im Dunklen das eben Gesehene noch nach und die Antizipation projiziert auf die schwarze Leinwand, was erst noch folgen wird, so wie in Maybe Siam, wo wir lauter Filmszenen mit Blinden zuerst nur zu hören kriegen, ehe wir sie dann – nun aber stumm – auch noch gezeigt bekommen. Vor allem aber entfalten sich in den schwarzen Pausen all jene Bilder die man gar nicht gesehen hat und auch nicht sehen wird, die aber dem Cinephilen im Kopf herumspuken. In einer Art optischem Phantomschmerz vergegenwärtigt das Schwarzbild die abwesenden Filmglieder. In all den Aufnahmen von Körperwunden, wie man sie in Cut zu sehen bekommt, wird man all die berühmten Bilder nicht finden, die man erwarten könnte: weder das ausgeschlagene Auge aus Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin noch der zerschnittene Augapfel von Buñuel und Dalí; weder das Messer aus Hitchcocks Psycho noch der sich öffnende Leib aus Cronenbergs Videodrome. Die Künstler wissen, dass wir diese Phantombilder ohnehin schon immer mit uns herumtragen, eingeätzt in unser von der Filmgeschichte verstrahltes Auge und Gehirn. So wird die Verweigerung dieser Bilder zum finalen Coup von Christoph Girardet und Matthias Müller. Spätestens hier, wo wir nicht anders können, als auf den schwarzen Screen unser eigenes Found Footage zu projizieren, haben diese Filme uns restlos in ihrer Gewalt. Selbst unsere Erinnerungen haben sie sich einverleibt. Wir finden uns rettungslos eingenäht in die Lücke zwischen den Bildern.
Verwendete Literatur:
Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild: Kino 1. Frankfurt a. M. 1989
Gilles Deleuze: Logik des Sinns. Frankfurt a. M. 1993
Sergej M. Eisenstein: «Béla vergisst die Schere.» (1926). In: Helmut H. Diederichs: Geschichte der Filmtheorie. Frankfurt a. M. 2004. S. 257–264
Sigmund Freud: «Fetischismus» (1927). Gesammelte Werke, XIV. London 1948, S. 309–317
Thomas Koebner (Hg.): Reclams Sachlexikon des Films. Stuttgart 2011
Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin 1967
Kataloge:
Christoph Girardet: A Stolen Life. Found Footage 1991–2003. Freiburg i. Br. 2003
Jens Hinrichsen: Christoph Girardet. Hannover 2012
Matthias Müller: Album. Film, Video, Photography. Frankfurt a. M. 2004