Filmbulletin: Vergleicht man Wir sind jung. Wir sind stark., Ihr Film von 2014, mit Berlin Alexanderplatz, könnte man sagen, dass Sie wohl ein Regisseur mit Sinn für Sozialkritik sind – aber genau so viel Sinn für eine experimentierfreudige Bildsprache und einen spielerischen Umgang mit Narration haben.
Burhan Qurbani: Man könnte mir als Filmemacher vorwerfen, dass ich stets zwischen Arthouse un…
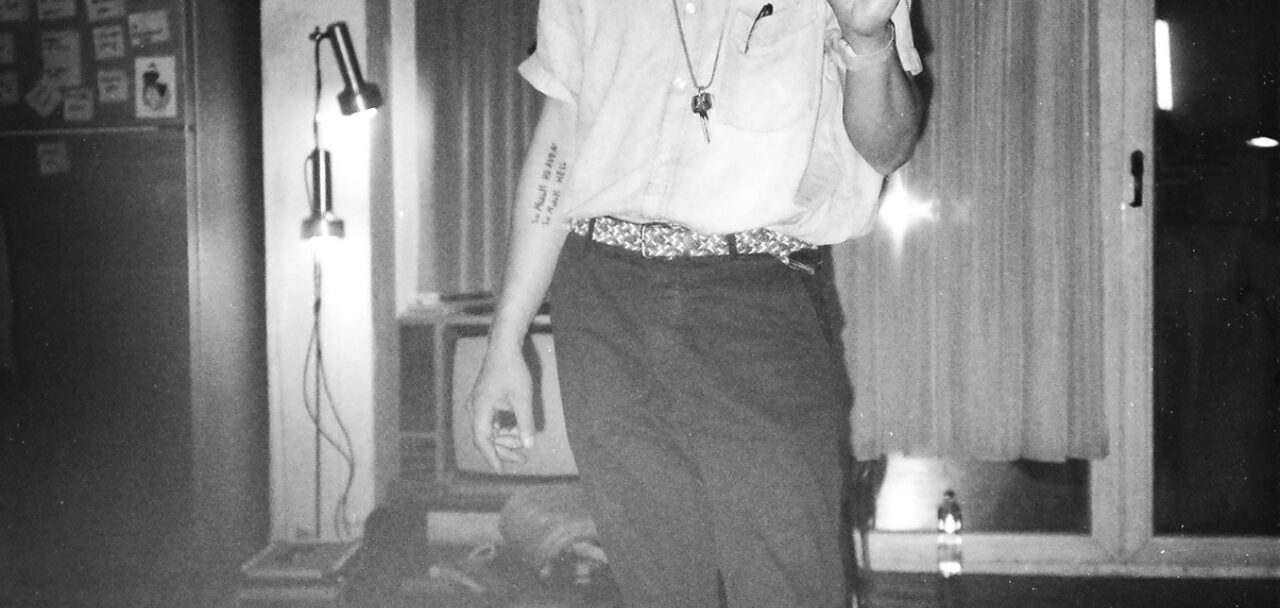
«Ich arbeite mich an diesem Land ab, das wohl meine Heimat ist»
Sein Film Berlin Alexanderplatz feiert gerade Premiere – mit Filmbulletin spricht Regisseur Burhan Qurbani über cineastische Einflüsse des New American Cinema, über die Hybris, sich mit Fassbinder zu vergleichen, und künftige Projekte.
