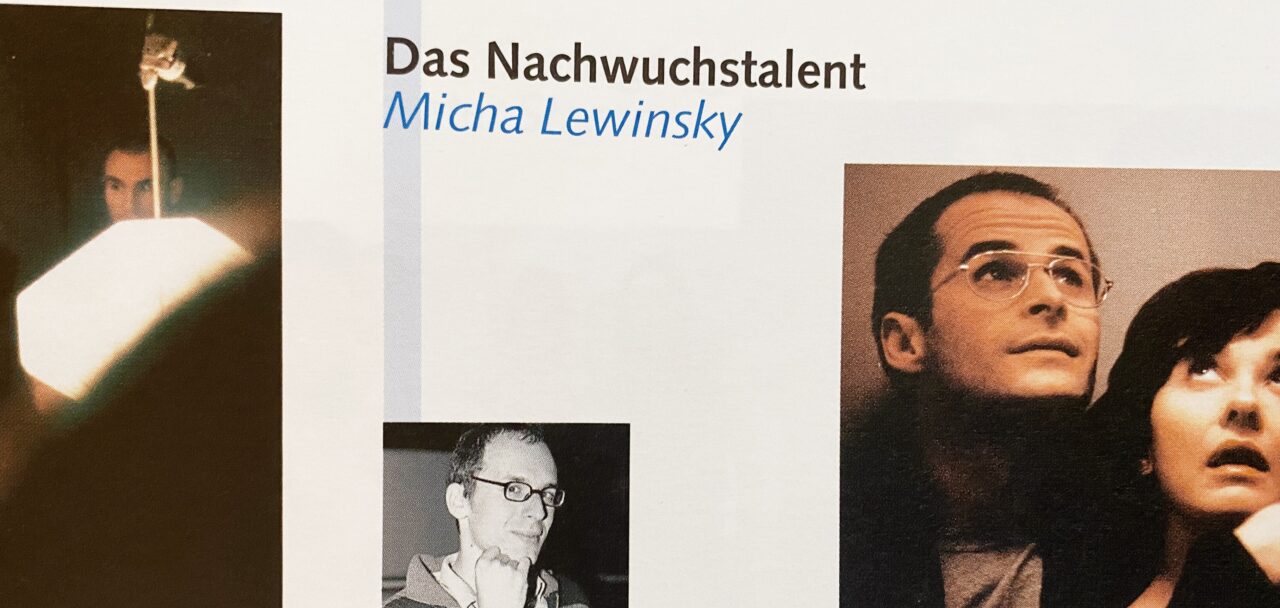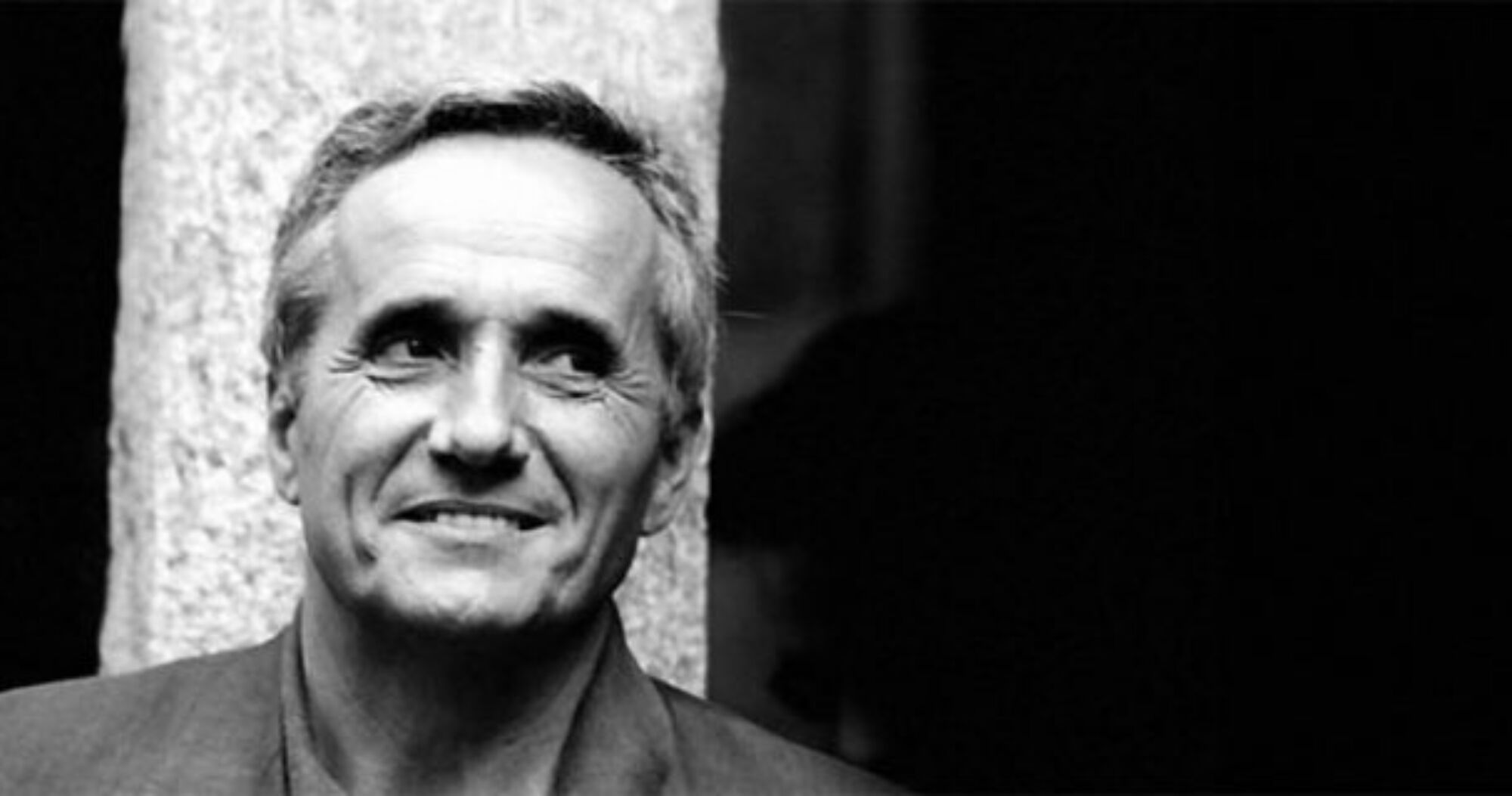Interview mit Micha Lewinsky
Entstehen durch Drehbuch-Workshops die besseren Filme?
So einfach ist es nicht. Aber ich finde die Ausbildungsprogramme total wichtig. Sie helfen jungen Autoren, Leute kennenzulernen, Kontakte ins Ausland zu knüpfen und in ihrem Selbstverständnis als Schreibende stabiler zu werden. Das Wichtigste ist, dass man einen Dramaturgen findet, der kontinuierlich mit einem zusammenarbeitet. Das ist für die Qualität eines Buches eigentlich wichtiger als das Programm. Mit Sabine Pochhammer habe ich eine der besten Dramaturgen gefunden, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Ich empfehle sie auch anderen Schweizer Autoren immer wieder. Programme habe ich seither nicht mehr besucht, aber bei jedem Buch lasse ich mich früher oder später von ihr beraten.
Ein Stoffentwicklungsprogramm ist ein Zusatzangebot, das ein Buch verbessern kann. Drehbuchwissen ist Allgemeinwissen. Das hat in den letzten Jahren vielleicht zu einer Normierung geführt. Es hat Filme zum Teil besser gemacht, andererseits ist es gefährlich, populäre Handbücher à la Syd Field zu lesen und das dann unverdaut zu benützen. Da ist eine gute Dramaturgin besser, die das vor Jahren vielleicht auch einmal gelesen hat, sich aber viel direkter mit dem Stoff beschäftigt und die Grundgesetze in Fleisch und Blut hat.
Was lernt man denn in solchen Beratungen?
Es geht nicht ums Lernen! Markus Imhoof ist in diesem Jahr bei «Step by Step», übrigens auch bei Pochhammer; und er, so erfahren wie er ist, muss ja nun wirklich nichts mehr lernen. Bei jedem neuen Projekt kann man aber wieder von neuem verzweifeln und vor Problemen stehen.
Haben die Seminare nicht zum Ziel, auch neue Einblicke ins Handwerk des Drehbuchschreibens zu vermitteln?
Nicht wirklich, denn das steht ja alles in etwa drei Büchern, die die meisten gelesen haben, darunter «Story» von Robert McKee oder «Script Writers Journey» von Christopher Vogler. Das sind Basics. Lehrreich sind die Rahmenprogramme, zum Beispiel Drehbuchanalysen, die ein Dramaturg abends noch zusätzlich macht. Diese Weiterbildungskurse haben im Gegensatz zur persönlichen Betreuung aber keinen direkten Einfluss auf das eigene Buch. Sabine arbeitet sehr figurenbezogen. Sie will einem nicht ihre Geschichten unterjubeln, wie das manche tun, und presst den Stoff auch nicht platt in eine Dreiaktstruktur. Sie hilft einem, zum Kern der eigenen Geschichte vorzustossen.
Demnach gibt es Berater, die eher nach Schema F arbeiten?
Ich kenne ja eigentlich nur Sabine, aber ich nehme an, dass etwa Don Bohlinger ein viel klassischerer Dramaturg ist. Das muss ja nicht schlecht sein. Bei einer fulminanten Romantic Comedy wäre er unter Umständen gut. Oder bei einem Thriller wie Das Experiment von Oliver Hirschbiegel, an dem er selber mitgeschrieben hat. Weniger sehe ich ihn bei einer feinen, fragilen Geschichte mit einem ziellosen Helden.
Weihnachten brachten Sie als Treatment zu «Step by Step». Gab es im Verlaufe des Seminars und bis zum fertigen Buch grosse Abweichungen?
Ich hätte viel mehr verändert. Aber Sabine bremste mich und sagte, ich solle doch erst einmal das ausarbeiten, was da ist. Ich neige dazu, schnell etwas zu verwerfen, weil ich's plötzlich schlecht finde. So habe ich gelernt, das Vorhandene zu pflegen und zu büscheln. Ich ging relativ naiv an die Sache heran und machte mir zum Beispiel keine Gedanken darüber, was ein Ensemblefilm ist. Ein Film mit vielen Figuren, ja, aber ich dachte, ich erzähle ja eh alles in einem grossen Bogen. So kümmerte ich mich nicht um die einzelnen Stränge. Sabine zwang mich, über das Thema des Films nachzudenken, über den inneren Grund, den Kitt, der alles zusammenhält: Nähe und Distanz, Einsamkeit und Beziehungen. So konnte ich die Geschichte verfeinern. Sie erhielt eine Ausrichtung, weil jetzt die einzelnen Geschichten zusammengehören.
Dass gerade Fernsehfilme thematisch oft überladen sind, ist eine häufige Kritik. Ihre Erfahrung?
In der Schweiz erlebe ich eine grosse Freiheit beim Schreiben von TV-Movies. Ich wurde nie dazu verdonnert, etwas zu schreiben, das ich nicht will. Es ist vielleicht einfach eine Konvention, dass man Fernsehfilme zügiger beginnt, weil man beim Fernsehen schneller wegschaltet, einem Film im Kino hingegen mehr Zeit gibt, bis er ins Laufen kommt. Da kann man auch mal zwanzig Minuten auf den Anstoss warten und die Welt der Figuren kennenlernen, bis etwas passiert. Wenn im Fernsehfilm das Telefon klingelt, denkt der Zuschauer: «In der Stadt ist eine Atombombe explodiert.» Im Kinofilm ist es aber nur der Coiffeur, der anruft und den Termin verschiebt. Dann geht die Figur in die Waschküche, trifft noch jemanden und so weiter. Dieses Tempo kann Zuschauern im Kino einen Charakter und eine Welt näher bringen, beim Fernsehen zappt man weg.
Ihr neuster Film Sternenberg entstand im Rahmen der Reihe «Fernsehfilme SF DRS». Zu welchem Zeitpunkt haben Sie hier Ihre Consultant angerufen?
In der Regel ist das sinnvoll vor Abgabe des
Treatments, wenn man langsam wissen sollte,
was für eine Geschichte man eigentlich erzählt.
Die zweite Krise folgt bei mir in der Regel kurz vor
Abgabe des Drehbuchs, wenn ich das Gefühl
habe, jetzt weiss ich nicht mehr weiter, jetzt habe
ich mich im Wald verloren. In diesem Moment ist
man ziemlich schutzlos, und es ist ganz wichtig,
dass man jemanden Guten findet, der einen nicht
nur zerreisst, sondern einem konstruktiv weiterhilft.
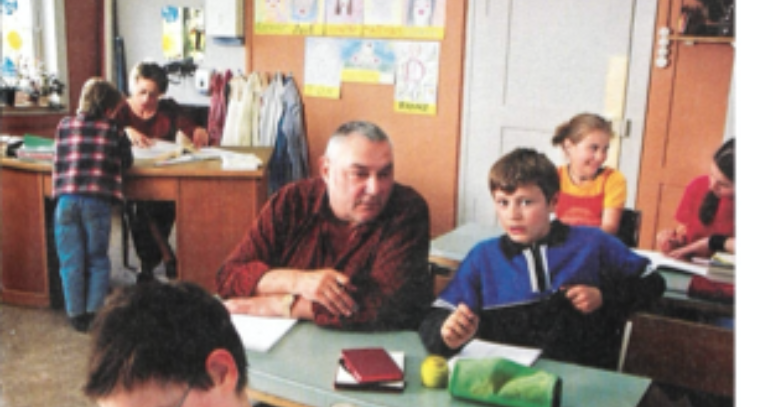
Sternenberg (Christoph Schaub 2004)
Was ist in diesen Drehbuchberatungen wichtiger: Figuren oder Plot?
Das greift ineinander. Eigentlich entwickelt sich am Schluss alles aus der Figur heraus. Manchmal hat man ein Plotproblem und löst es, indem man etwas über die Figur herausfindet. Das haben wir jetzt bei «Liebes Leben» erlebt: Irgendetwas war mit dem zweiten Akt noch nicht in Ordnung, etwas stimmte nicht mit dem ersten Wendepunkt. Man überlegt und überlegt und merkt dann, dass die zweite Hauptfigur noch nicht richtig charakterisiert ist, dass man den Konflikt zwischen ihr und der ersten Hauptfigur noch nicht kennt. Und plötzlich gibt es durch eine genauere Figurenzeichnung den gesuchten Wendepunkt gratis dazu.
Wie schreiben Sie Dialoge? Sie werden als sehr echt und lebensnah gerühmt.
Im Grunde scheint mir das Schreiben von Dialogen gar nicht so schwierig, solange man eine Figur nicht dazu zwingt, etwas zu tun oder zu sagen, was sie nicht will. Zum Beispiel: Weil das für die Dramaturgie der Geschichte wichtig ist; soll eine Figur einen Streit mit dem Kellner beginnen. Damit will man etwas auslösen, das man später braucht. Wenn es aber keinen triftigen Grund für den Streit gibt, wird das der schrecklichste Dialog, den man sich denken kann. Da kann man sich noch so Mühe geben. Wenn man im Vorfeld aber zeigt, dass die Gereiztheit in der Figur angelegt ist, und der Kellner genau das macht, was der Figur sowieso auf die Nerven geht, dann fängt die Figur wie von selbst zu streiten an.
Können Sie die Kontrolle über ein Buch leicht abgeben, wenn es dann mal inszeniert wird und sich zwangsläufig verändert?
Wenn man ein Buch mit dem späteren Regisseur zusammenschreibt, dann übergibt man die Führung des Projekts automatisch. «Du bist der Chef», sage ich dann, das werden sie später auch beim Casting oder auf dem Set sein. Es ist auch eine Vertrauensfrage. Mehr Mühe loszulassen hatte ich bei Weihnachten, weil ich merkte, dass der Regisseur meinen Stoff nicht geliebt hat. Ich hatte einen ganz anderen Zugang zum Stoff als er. Egal. Ich dachte nach diesem ersten Film, das werde so bleiben, dass einem am Schluss etwas weggenommen und zerstört wird. Man baut liebevoll eine Puppenstube, und am Ende trampelt dann einer mit Gummistiefeln quer durch. Mit Anna Luifs und Christoph Schaubs Umsetzungen bin ich aber sehr zufrieden. Es ist sogar schön, wenn ein Regisseur eigene passende Bilder hinzuerfindet und die Figuren zum Leben erweckt.
Der Drehbuchautor fristet in der arbeitsteiligen Filmproduktion immer noch ein geringes Ansehen. Wie gehen Sie mit dem minderwertigen Status um?
Bei diesem Thema bin ich immer gleich auf Hundert! Viele Leute stecken noch voll in der Autorenfilmzeit und merken gar nicht, dass es eine Veränderung gegeben hat. Für sie ist immer noch der Regisseur der einzig relevante Urheber eines Films. Das mochte früher seine Berechtigung haben, als der Regisseur eben auch Autor war. Aber wenn ich heute ein Drehbuch geschrieben habe und es einer Regisseurin gebe, dann ist es eben auch ein Autoren-Regisseurinnen-Film. Wenn ich aber an ein Festival gehe, wo dieser Film läuft, muss ich froh sein, wenn ich eine Gratis-Akkreditierung erhalte, während der Regisseur eingeflogen und gehätschelt wird. Da werde ich einfach sauer. Ich finde wirklich, dass man von der «Ein Film von»-Haltung wegkommen müsste und in solchen Fällen den Namen von Autor und Regisseur nennen sollte.
Die Bemühungen gibt es ja.
Das stimmt. Wir haben eine Gruppe «Scénario» gegründet, eine Vereinigung von Schweizer Drehbuchautorinnen und -autoren. Wir verlangen, dass es in nächster Zukunft auch einen Schweizer Filmpreis «Bestes Drehbuch» gibt.
Jean Renoir hat einmal gesagt, Film könne kein Kunstwerk im klassischen Sinn sein, da viel zu viele Leute daran arbeiten und es nicht das Ergebnis einer persönlichen Sichtweise sei. Beim Drehbuch ist es noch krasser als beim Inszenieren, und auch im Workshop wird Ihnen ja in Ihre Arbeit dreingeredet. Haben Sie keine Probleme damit?
Der einzige Bereich, bei dem alle dreinreden, ist neben dem Casting das Drehbuch - grosses Jekami, danach kommt kein Fördergremium mehr aufs Set und sagt dem Beleuchter, wie er das Licht setzen soll.
Input ist wichtig. Das Feedback gehört dazu, und die Besonderheit von «Step by Step» ist, dass die Rückmeldung von verschiedenen Seiten kommt. Man muss das annehmen können und kommt ja eventuell auf Mängel, die man beheben kann.
Wird mit der frühen Einflussnahme vieler Stimmen auch auf die Vielzahl von Köpfen in den Fördergremien vorgearbeitet?
Wenn ich es nicht schaffe, drei Leute in meiner Gruppe zu überzeugen, dass das ein gutes Buch ist, wird es schwierig werden, ein ganzes Gremium zu überzeugen. Schwieriger wird es, wenn Leute mit Entscheidungsgewalt mitreden und bestimmen, etwa wenn jemand seine Förderung von einer weiteren Frauenfigur oder dreissig Prozent mehr Humor abhängig macht, von etwas also, das nicht im ursprünglichen Stoff liegt. Aber man muss sich immer vor Augen halten: Ein Drehbuch ist eine Absichtserklärung auf hundert Seiten und nichts Literarisches.