FILMBULLETIN: Eure beiden Filme Der Schuh des Patriarchen und Reisen ins Landesinnere scheinen mir in ihrer Machart, in ihrem Zugang auf und dem Umgang mit den Leuten, in ihrem Anspruch an ein mitgestaltendes, mitdenkendes Publikum verwandt. Von daher die Idee zu diesem gemeinsamen Gespräch, das von eurer Filmarbeit im Speziellen, aber auch vom Dokumentarfilmschaffen in der heutigen Schweiz handeln soll. Inwieweit fühlt ihr euch selber einander verwandt?
MATTHIAS VON GUNTEN: Die wichtigste Ähnlichkeit scheint mir in der Idee zu liegen, die Art und das Gedankengut von Leuten zu zeigen, als eine Art Rohmaterial, ohne die Absicht, in erster Linie ein Urteil zu suchen. Dokumentarfilme werden ja sehr oft gemacht, um ein eigenes Urteil, eine eigene Meinung zu vermitteln, anhand von Dingen, die andere äussern. Ich denke, dass wir beide versucht haben, die Art, das Wesen, die Denkart von Leuten zu zeigen, zunächst ohne Wertung und Kommentar. Unsere Haltung drückt sich eher in der Bahauptung aus, dass das, was wir zeigen, wichtig und interessant ist, aber auch in unseren Bildern und in der Montage. Ich habe das beim Film von Bruno stark so empfunden, und das ist etwas, was ich auch so versucht habe.
BRUNO MOLL: Die stärkste Ähnlichkeit dürfte Reisen ins Landesinnere mit meinem Film Samba lento haben, denn Matthias verzichtet ja ziemlich klar auf fiktive Elemente. In der Haltung, in der wir auf die Leute zugehen möchten, in der Art, wie wir einen Film gestalten wollen, sind wir uns tatsächlich ähnlich. Für mich ist das die einzig mögliche Form, es sei denn, man definiere seine Arbeit klar als Agitprop, als manipulatives Werk. Das kann es geben, das soll es geben, gewisse Themen wird man wohl nur so anpacken können. Mein Hauptmotor aber ist das Bedürfnis, jemanden kennenzulernen, und so kann ich mich nicht anders verhalten, als ich das in meinen Filmen bisher gemacht habe. Mich interessiert der betreffende Mensch tatsächlich, ich gebe das nicht nur vor. Ich suche keine Showobjekte. Wichtige Dokumentarfilme haben meistens ein Element des Ernstnehmens eines Gegenübers.
FILMBULLETIN: Wenn wir jetzt mal von euren beiden neuen Filmen ausgehen: Wie bist du, Bruno, auf die Bally-Geschichte gekommen, wie hast du, Matthias, deine sechs Personen ausgewählt?
BRUNO MOLL: Die Bally-Geschichte ist bei mir seit meinem ersten Film, Gottliebs Heimat, klar. Gottlieb war ja einer der ersten Entlassenen beim ersten grossen Streik, weil er sich organisieren liess. Neben seiner unglücklichen Liebesgeschichte, neben den Schwierigkeiten, einen eigenen Bauernhof zu kaufen, war seine Aussperrung aus dem Bally-Betrieb ein Hauptgrund für den Plan, nach Amerika auszuwandern. Bei den Recherchen zu dieser Zeit landete ich im Bally-Archiv und habe dabei diese Tagebücher entdeckt. Mir war damals schon klar, dass ich mit diesen Tagebüchern einmal etwas machen wollte.

(Bild: Der Schuh des Patriarchen)
MATTHIAS VON GUNTEN: Bei mir müsste man auch weiter zurückgehen, denn die Form, wie der Film jetzt ausschaut, entstand erst im Verlauf der Vorbereitungen und war nicht die ursprünglichste. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass ich während sieben Jahren im Ausland gelebt habe, weil ich, aus all den bekannten Gründen, das Gefühl hatte, ich könne in der Schweiz nicht leben. Als ich zurückkehrte, bin ich auf dieselben Phänomene gestossen, um derentwillen ich einmal abgehauen war, nur hatte ich mich dazu entschieden, ihnen neu zu begegnen, mich mit ihnen zu befassen.
Der Abstand hat mir den Blick von aussen ermöglicht, und mit diesem Blick wollte ich eigentlich die Schweiz wieder betrachten. Ich habe begonnen, Notizen zu sammeln über Dinge, die mir auffielen, oder etwas von dem ausdrückten, was mich an der Schweiz beschäftigt, Szenen, Leute, Momente, Situationen, die ich mir in einem Film vorstellen konnte. Mir schwebte ursprünglich ein Film vor, der viel mosaikartiger, viel fragmentarischer als der jetzige herausgekommen wäre. Immer mehr hat sich das dann auf einzelne Leute verdichtet, weil ich gemerkt habe, dass das das Interessanteste zum Verfolgen ist. Die Auswahl erfolgte schliesslich so, dass die einzelnen Personen zusammen in ihrem ausschnitthaften Charakter ein Gebilde, ein Netz ergeben, das etwas mit diesem Land zu tun hat. Es steckt keine Theorie dahinter, sondern – neben dem persönlichen Interesse – ein intuitives Verteilen von Gewichten oder Bereichen.
BRUNO MOLL: Das ist ein anderer Ansatz als bei mir, denn ich bin eigentlich nie weggegangen, ich bin heute noch da, bin heute noch in Olten und habe es eigentlich von innen her aufzubrechen versucht. In meinen Filmen steckt auch eine Art Provinzialität, sie spielen alle irgendwie in meiner näheren Umgebung. Zu dem, was ich vorhin als Ausgangspunkt für meinen Film geschildert habe, kommt ein starkes Interesse an Ökonomie und Wirtschaftsfragen, das sich in den letzten Jahren bei mir entwickelt hat. Für mich ist das genauso Neuland, und in der alten Geschichte mit Gottlieb konnte ich auf neue Art wieder etwas aufleben lassen. Hans Stürm und Beatrice Leuthold haben sich seinerzeit bei Gossliwil die Frage gestellt: «Was isch en Puur?» Sie haben das aus einer Art städtischer Naivität heraus gemacht und gingen auch so an ihr Thema ran. Meine Frage: «Was isch en Unternähmer?», resultiert aus einem ähnlichen Ursprung.
MATTHIAS VON GUNTEN: Bruno hat davon gesprochen, dass er sich für einzelne Leute interessiert. Die Auswahl, die ich getroffen habe, besteht zum Teil aus Leuten, mit denen ich in meinem Alltag nichts zu tun habe. Das war damit effektiv auch eine Expedition in Bereiche und in Welten hinein, die ich sonst eigentlich nicht kenne. Der Film hat mir die Möglichkeit gegeben, Leute und ihre Welt kennenzulernen, die mir bisher eigentlich fremd waren, von denen ich aber das Gefühl habe, dass sie in dieser Schweiz alles andere als fremd sind.
BRUNO MOLL: Ich würde sogar behaupten, dass in jedem von ihnen etwas von dir angelegt ist, und deshalb interessiert man sich ja auch für die Personen. Wer könnte einen dazu drängen, sich mit jemandem zu beschäftigen, der nicht in einem selbst angelegt ist. Ich habe es oft erlebt, dass mich Leute ungläubig angegangen sind: Wie kannst du dich mit solch einer Welt beschäftigen?
MATTHIAS VON GUNTEN: Bei mir war das doch etwas verschieden, denn meine Idee war ursprünglich eine sehr intellektuelle. Ein wirklich nahes Verhältnis habe ich nur zu der alten Frau gehabt und zu Hans im Tessin. Die anderen habe ich zum Teil aus einem intellektuellen Kalkül heraus ausgewählt. Das kippte dann beim Drehen, weil du mit dieser Haltung auf die Dauer nicht arbeiten kannst. Du machst so die Leute entweder kaputt, du kommst gar nicht an sie ran oder drängst sie in eine Ecke, in der sie nichts mehr verloren haben. Durch die Arbeit mit den Leuten haben sich eine andere Haltung und ein anderes Interesse entwickelt, und ich habe sie viel näher kennengelernt, als ich mir das je gedacht hätte.
FILMBULLETIN: Du hast von einem intellektuellen Kalkül gesprochen. Wie lange geht so etwas denn auf, wo tauchen die Grenzen auf, an denen man das während der Arbeit aufgeben muss? Der Manager Niederer im Schuh des Patriarchen beispielsweise: Er ist die einzige Figur, die durch den ganzen Film hindurch präsent ist, weil die Unternehmer-Geschichte vorläufig bei ihm endet. Wie weit kalkulierst du nun mit ihm, wie weit lässt du dich überraschen, wie nahe kannst du ihm überhaupt kommen?
BRUNO MOLL: Ich glaube nicht, dass ich ihm nähergekommen bin. Man gerät in der Auseinandersetzung nun sehr schnell in den Bereich von Klischees, etwa jenem, dass ein Unternehmer einfach ein kühler, berechnender Typ ist. Man muss immer davon ausgehen, dass diese Leute in einem bestimmten System funktionieren, und dass sie aus bestimmten Gründen eben auch das sind, was sie sind. Es wird nicht einer Manager, wenn er, wie Hans in deinem Film, am liebsten aussteigen möchte. Man muss schon auf eine bestimmte Art funktionieren, dass man das überhaupt kann. Niederer hat immerhin 11 000 Leute «unter sich» – er selber redet ja viel von oben und unten. Nähergekommen bin ich ihm in dem Sinn, dass er sich öffnete. Man müsste ihn mal fragen, aber ich denke, dass er mir näher gekommen ist als ich ihm. Am Anfang gingen wohl beide mit vergleichbaren Klischees aufeinander zu. Er hat sich mir genähert mit Ängsten, ein Filmer, also links. der haut uns in die Pfanne. Und ich bin auf ihn gestossen mit dem Bild vom Manager, kühl, berechnend. kleines Mönsterchen. Und begegnet bin einem Menschen im System, mit Sympathien und vielen Fehlern auch, die er in seinen Widersprüchen in den Film einbringt. Wenn ich ein Verdienst habe, so wohl das, dass ich ihn so weit in den Film integriert habe, dass man ihn als Person wirklich spürt, dass er nicht irgendeine Rolle spielt.
MATTHIAS VON GUNTEN: Warum hast du ihn nur in einer Situation gefilmt, nur in einem Gespräch? Ich habe mich immer gefragt, wie ein solches Gespräch auf ihn wirkt, und dass er, wenn man es unterbrechen würde, auch Gelegenheit hätte, darüber nachzudenken. Ich hätte mir eine Fortsetzung gewünscht, um zu sehen, ob sich da eine Entwicklung ergibt, oder ob er seinen Level auch zwei Wochen später halten will.
BRUNO MOLL: Den Wunsch dazu hätte ich schon gehabt, aber da war einerseits die finanzielle Frage, da Interviews auf Film gedreht extrem teuer sind, andererseits ist ein Manager in seiner Position sehr schwer auf ein Datum zu fixieren. Mir ist es auch vorgeschwebt, ihn zu begleiten, auf Reisen mitzugehen, aber in solchen Momenten stösst man eben immer wieder an die Grenzen des Dokumentarfilms, vor allem bei unserer Mentalität. In Italien hätte ich das machen können. Einen italienischen Manager hätte ich verfolgen können, weil die mit diesem Aspekt der Medien umgehen können. Das schaffen sie hier nicht. Da geschieht immer alles im Stil einer Pressekonferenz. Die Medien sind für sie dazu da, an eine Pressekonferenz zu kommen, um etwas in Empfang zu nehmen und das zu verbreiten. Sie können das Spiel nicht. Es war schon viel, dass ich es schaffte, mit der Kamera an einer Sitzung teilnehmen zu können, in der sie sich immerhin darüber beraten, der Konkurrenz jemanden abzujagen. Ich war erstaunt, dass dies vor laufender Kamera passiert. Natürlich hätte ich mich auch zeigen können, aber andererseits dachte ich mir, wieso soll ich nicht auf seinem Gesicht verweilen, auf seinem Körper, auf seiner Gestik, auf seinem Raum, den er sich selber ausgesucht hat, an dem Platz, an dem er sitzen will. Er wusste nicht, worum sich unser Gespräch drehen würde. Er wusste nur, dass es lange dauern sollte und dass er sich zur Verfügung halten musste.

(Bild: Reise ins Landesinnere)
FILMBULLETIN: Bei dir, Matthias, gibt es ja dieses mehrmalige Aufsuchen der einzelnen Personen, nur scheint der Fall da anders zu liegen: Du willst von den Leuten weniger etwas von der intellektuellen Ebene her.
MATTHIAS VON GUNTEN: Meine Grundhaltung gegenüber den Personen war es, an ihrer Zeit teilzunehmen. Dies aus der Idee heraus, wenn man die Leute in ihrem Alltag beobachtet, in ihrer Tätigkeit, bei Dingen, auf die sie sich konzentrieren, müsste man über das Sehen, über das Schauen etwas erfahren über sie, und dies müsste voluminöser, vielschichtiger sein, als es durch ein Gespräch möglich wäre. An der Zeit teilnehmen heisst auch über eine längere Zeit hinweg. Ich glaube, wenn man jemanden über eine längere Zeit hinweg in seinen Entwicklungsschritten verfolgen kann, so erfährt man auch wieder etwas über ihn oder über sie, ohne dass man Fragen stellen muss und gleichzeitig auch, ohne indiskret zu werden. Man kommt den Personen so auf eine feine Art nahe. Das dritte war sicher die Anlage des Filmes, in der immer etwas geschehen muss, auch wenn es etwas kleines ist, was sich wiederum in etwas anderem fortsetzt. Der Zwang zum Fluss, den ich mir setzte, wäre mit Gesprächen schwer einzuhalten. Ich schneide nicht gerne von einem Gespräch zum anderen.
FILMBULLETIN: Mich interessiert die Frage schon noch weiter: Wie nahe kann man als Filmemacher überhaupt an die Leute rankommen, wie nahe wollt ihr überhaupt kommen, wo lagen gerade im Fall vom Schuh des Patriarchen aber auch bei deinem Fernsehfilm Hungerzeit die systembedingten Grenzen? Es ist wohl ein Unterschied, ob man sich in einem Grosskonzern bewegt oder auf Einzelpersonen zugeht. Mich würden die Grenzen sowohl in der Wirtschaft als auch im Privatbereich interessieren, für euch wie für die anderen.
BRUNO MOLL: Das ist für mich eine schwierige Frage, bei der ich mir nicht einmal so sicher bin, ob ich über sie öffentlich nachdenken will. Wieso nehme ich in meinen Filmen vielfach Figuren oder eben Menschen – vielleicht ist es typisch, dass ich Figuren sage, vielleicht hat das auch eine Wahrheit –, wieso nehme ich Menschen, um sie aus einer gewissen Distanz zu betrachten? Da ist sicher primär ein intellektuelles Interesse, ich möchte ganz einfach auch das Leben in seinen Facetten kennenlernen. Ich erfahre viel von diesen Personen, aber mir mangelt es an etwas, ich möchte durchaus näher an die Leute rankommen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass es vermutlich Filme gibt, bei denen man diesen Eindruck von Nähe hat, die aber überhaupt nicht näher sind, sie gehen bloss spekulativer um mit dem Medium. Wenn ich es gewollt hätte, so hätte ich diese Art von Nähe immer wieder in meine Filme hineinmogeln können. Die Tendenz, die Nähe mit Weinen verwechselt, existiert. Bei Paul Riniker zum Beispiel weint sich regelmässig jemand vor der Kamera aus, und man fragt sich: Ist der Filmemacher dieser Person jetzt nahe! Das geht für mich in einen Bereich hinein, den ich nur noch spekulativ nennen kann. Es ist nicht jene Nähe, die ich suche. Ich habe einen grossen Respekt vor den Leuten, vielleicht auch zuviel Respekt, der mich daran hindert, auf den letzten Punkt loszusteuern. Ich werde das wohl nie schaffen. Meine Filme sind dafür immer wieder überladen mit Sprache. Da kommen die Emotionen, die beispielsweise in Reisen ins Landesinnere auf eine ganz natürliche Art entstehen, zu kurz.
MATTHIAS VON GUNTEN: Ich habe den Eindruck, dass ich übers Schauen viel über Menschen erfahre. Das führt so weit, dass ich manchmal wegschaue, weil ich das Gefühl habe, das Hinschauen sei indiskret. Selbst dann, wenn der andere es gar nicht merkt. Das ist keine Frage des schlechten Gewissens, aber es kann mir plötzlich wie zu nahe gehen. Die. Neugier ist vorhanden. Bei mir war es wirklich so, dass ich jeden Moment, den ich diesen Leuten mit der Kamera zusehen konnte, als Geschenk empfand. Sie teilten mir etwas mit und wussten nicht, wieviel sie selbst in den einfachsten Momenten von sich preisgaben. Mir würde das genau gleich ergehen: Wenn jemand mich filmen würde, so wüsste ich im Moment sicher nicht, wieviel ich von mir preisgebe, wieviel man durch blosses Zuschauen über mich erfährt. Aus dieser Mischung von Neugier und Wissen um das Ausgeliefertsein der Leute, die das ja bewusst machen, entsteht eine Verantwortung, die nicht nur moralisch ist. Du musst wissen, dass du den eigenen Film kaputtmachst, wenn du mit dieser Verantwortung falsch umspringst. Bei meinem Film war es so, dass alle das Material sowohl ungeschnitten wie auch geschnitten gesehen haben, bevor jemand anders es gesehen hat. Aber es ist praktisch nicht passiert, dass jemand eine Szene nicht im Film haben wollte. In dem Moment, da du mit Leuten einen Dokumentarfilm machst, sind sie es, die mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Wesen Priorität haben vor deiner Idee. Anderseits kommt es beim Realisieren eines Dokumentarfilmes immer wieder vor, dass du denkst, jetzt müsste der doch dies oder das sagen, dass du Lust hättest, jemanden zu etwas zu drängen oder etwas zu inszenieren ...
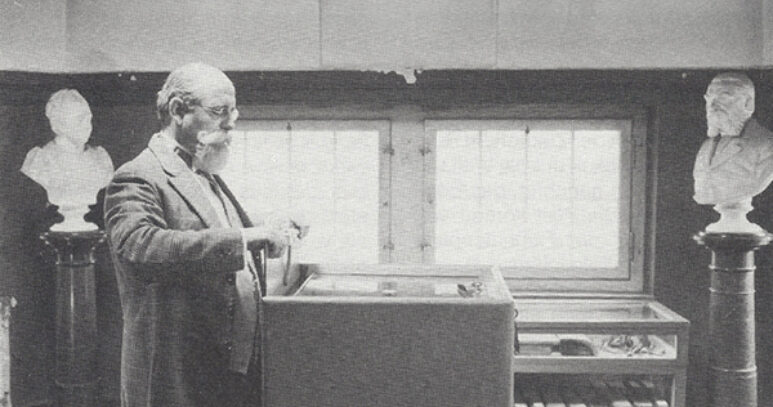
(Bild: Der Schuh des Patriarchen)
FILMBULLETIN: ... du hast schon inszeniert, beim Fernsehen beispielsweise, wo es Schuss-Gegenschuss gibt ...
MATTHIAS VON GUNTEN: ... wir haben gewisse Dinge inszeniert, aber da ist das meiste in der Montage rausgefallen. Wenn es beispielsweise bestimmte Dialoge gegeben hat, die mir gefielen, so habe ich manchmal gesagt, komm, mach das noch einmal, das war so gut, und wir hatten die Kamera nicht laufen. Von solchen Aufnahmen fielen 99 Prozent wieder raus, weil du ganz einfach spürtest, dass sie es bei der effektiven Aufnahme nicht wirklich sagten. In dem Moment, da du versuchst, die Leute in eine bestimmte Richtung, die dir genehm wäre, zu zwingen, blockierst du sie. Sie spüren, dass du etwas willst, versuchen, es dir recht zu machen, sind nicht mehr sich selber, und schon kannst du die Szene vergessen. Für mich ist das das grösste Problem beim Dokumentarfilm, dass man sich selber derart zurücknehmen muss.
BRUNO MOLL: Man darf da keinen Mythos daraus machen. Man darf nicht vergessen, dass diese Filme montiert sind. Wenn man das Rohmaterial anschauen würde, so wäre man erstaunt, was alles auf die Spitze getrieben wird, dass man es überhaupt betrachten kann. Man darf das nie vergessen. Ich bin einer, der immer behauptet: Je besser man Leute kennenlernt, desto weniger macht man Filme über sie. Da steckt für mich auch die Wurzel dafür, dass ich mit fiktiven Elementen zu arbeiten begann. Die gibt es bereits in Samba lento sehr stark, nur hat sie dort niemand wahrgenommen. Da gibt es Einstellungen, die absolut inszeniert sind, in denen im Raum drin sich plötzlich etwas anderes sich zu ereignen beginnt. Die sind so gemacht, dass man das Gefühl hat, sie wären dokumentarisch. Ich habe diese Distanzierung bald gesucht, weil ich zum vornherein gewusst habe, dass ich der absolut entscheidende Motor bin, einen eigenen Film zu machen. Alle anderen sind Vehikel, die gebraucht werden. Sie werden vielleicht nicht missbraucht, aber sie werden gebraucht. Es geht vor allem darum, über meine Existenz etwas zu erfahren. Ich wollte dem Film Das ganze Leben einmal den Titel geben: «Liebe Beute». Das ist für mich der genauste Titel für meine Arbeit überhaupt. Alle haben mir dann davon abgeraten, weil man ihn nicht verstehen würde. Es ist immer eine Art Beute, die ich filme, die ich zwar gerne habe, aber letztlich für mich ausbeute. Ich kenne keine Dokumentarfilme, bei denen es dieses Element nicht geben würde. Das ändert nichts an jener Redlichkeit gegenüber dem Gegenüber, die du vorher gut erklärt hast. Durch das Einfügen von fiktiven Elementen habe ich das noch verstärkt.
MATTHIAS VON GUNTEN: Es ist doch beides. Als Filmemacher bist du ein absoluter Egoist, der nimmt und nimmt und nimmt und nach seinen eigenen Vorstellungen etwas zu machen versucht. Das andere ist die Frage, wie du mit den Leuten umspringst, in dem Moment, da du wirklich etwas filmen willst mit ihnen. Dort kommst du mit dem eigenen Willen an Grenzen, es sei denn, du gehst aufs Inszenieren. Ich wäre eigentlich zu jeder Manipulation bereit gewesen, weil ich wusste, worauf ich hinauswollte. Nur: Das hat nicht funktioniert. Damit war mir eine Grenze gesetzt.
BRUNO MOLL: Ich habe Mühe mit der Unterscheidung zwischen Spiel- und Dokumentarfilm. Ein Film ist für mich ein Film, und in der Regel sind bei uns die meisten Filme ohnehin inszenierte Dokumentarfilme, weil wir in der Schweiz mit der Fiktion uns schwertun ...
FILMBULLETIN: ... oder dokumentierte Inszenierungen.
MATTHIAS VON GUNTEN: Da fehlt tatsächlich der Mut, darüber hinauszugehen. Es steckt überall etwas sehr Braves drin.
FILMBULLETIN: Bruno, du hast bereits den Vorwurf hören müssen, du würdest ein Unternehmerbild zeichnen, das den Arbeiter ausschliesst. Ich kann diesen Vorwurf nicht nachvollziehen, denn die Arbeiter und das Wesen von Arbeit in diesem Betrieb bestreiten einen schönen Teil deines Filmes. Trotzdem: Worauf führst du diese Kritik zurück?
BRUNO MOLL: Wir sind wortlastig, unsere Kultur ist derart wortlastig. Wer redet, der wird wahrgenommen. Die Fähigkeit zu schauen, wie Matthias das vorher beschrieben hat, ist kaum entwickelt. Während rund einem Drittel der ganzen Filmzeit sieht man Leute an ihren Maschinen arbeiten. Wenn man in die Fabrik geht, so arbeiten die Leute den ganzen Tag. Sie reden in den Pausen. Ich hätte natürlich die Pausen filmen können, jemanden zeigen können, der singt, was es auch gab. Ich hätte inszenieren können, wie sich zwei Frauen über die Maschinen hinweg miteinander unterhalten. Nur: Diese Momente von Verbaläusserungen sind sehr dünn gesät im Alltag eines solchen Betriebs. Auf der anderen Seite ist die Unternehmerschaft, und die spricht permanent, hält eine Sitzung nach der anderen ab. Ihr Instrument ist das Reden, die Sprache, das Wort: Die Arbeiterinnen und Arbeiter sitzen an ihren Maschinen und schaffen. Ich hätte natürlieh hingehen können und den Arbeiter fragen: «Was denkst du vom Unternehrner? » Das hätte es vielleicht etwas emotionaler gemacht, die Zuschauer könnten sich zurücklehnen und alle Denkarbeit wäre ihnen abgenommen. Aber ich bin so naiv, dass ich als Überbleibsel von Aufklärung noch daran glaube, dass eine Auseinandersetzung in einer vertiefteren Art und Weise zu geschehen hat und nicht durch ein spekulatives Aneinanderreihen von Position und Gegenposition. Ich hätte das machen können, einen Märtyrer ausserhalb des Betriebes aufbauen, einen Entlassenen mit zehn Kindern in einer einfachen Stube. Nur, was habe ich gefunden? Ich habe Gewerkschafter gefunden, die mir stundenlang davon schwärmten, wie sie mit den Direktoren in Waldhütten Feste feiern. Hätte ich das gebracht, so hätte man wieder gefragt: Ja, aber der Arbeiter? Je weniger die Leute wissen, was ein Arbeiter ist, desto mehr stellen sie diese Frage. Ich hätte echt Schwierigkeiten gehabt, jenen Arbeiter aufzuspüren, den jene Leute, die jetzt danach fragen, sehen wollten. Der Arbeiter hat das Wort nicht, darum ist er dort wo er ist, darum ist er nicht Unternehmer – das ist eine Realität, ob man die gut findet oder nicht. Und wenn er noch etwas sagen wollte, so sehe man hin: Die meisten können nicht einmal deutsch. Es sind Türken, Spanier, Jugoslawen – die Schweizer sind vorwiegend in Kaderpositionen, die Italiener sind bereits Vorarbeiter, die andere Nationalitäten befehligen. Ich sage nicht, dass das nicht eine interessante Frage wäre, jene nach der Position des Arbeiters heute, nur dürfte die Antwort darauf kaum noch dem Bild entsprechen, das sich gewisse Leute vom Arbeiter noch machen. Ich habe Arbeiter gefunden, die eine Solidarität zum Unternehmen entwickeln, die erstaunlich ist.

(Bild: Reisen ins Landesinnere)
FILMBULLETIN: Deine Frechheit ist es wohl einfach, dass du dich mit der Perspektive des Unternehmers beschäftigst, mit der des Starken.
BRUNO MOLL: Das ist das Ungeheuerliche. Ein Film übernimmt in der Regel die Position des Schwächeren. Das scheint ein ungeschriebenes, ethisches Gesetz zu sein. Ich habe das auch schon angedeutet: Ich würde gerne eine Trilogie der Macht machen. Mich hat es interessiert, wer in unserem Land etwas zu sagen hat. Natürlich kann ich mich mit einer schillernden Clochard-Figur abgeben. Nur das, was um uns herum passiert, HB-Südwest in Zürich und solche Dinge: Dahinter stecken Motoren, die unsere Gesellschaft prägen. Natürlich hat der Clochard auch eine Funktion, aber ich bin erstaunt, dass man sich nach zwanzig Jahren Arbeiter- und Aussenseiterfilmen nicht mal mit jemandem beschäftigen darf, der wirklich Macht auszuüben hat.
FILMBULLETIN: Du, Matthias, hast das Problem noch nicht gehabt, dass man dir vorwarf, du würdest die Leute einfach reden lassen.
MATTHIAS VON GUNTEN: Bis jetzt nicht. Es haben ganz wenige Leute gefunden, der Typ am Flughafen werde blossgestellt. Ich hatte den Eindruck, dass die meisten sehr gerne anderen Leuten ganz einfach zuschauen. Ich glaube, dass sehr viele Leute die Neugier, die ich habe, auch mitbringen.
FILMBULLETIN: Wenn die beiden Filme in ihrer Befriedigung einer solchen Neugier vergleichbar sind, woher mag denn die unterschiedliche Reaktion rühren?
MATTHIAS VON GUNTEN: Die Leute haben ein starkes Klischee eines Unternehmers. Von den Leuten, die in meinem Film vorkommen, existiert kein Klischee, weil man sie gar nicht kennt. Beim Unternehmer wollen sich die Leute ihr Bild nicht kaputtmachen lassen, dass er ein böser Ausbeuter ist, dem man schon gar nicht zuhören dürfte. In Brunos Film werden sie damit konfrontiert, dass man einem solchen Menschen zuhört, dass man ihm ein normales Interesse entgegenbringt, ohne ihn zum vornherein zu verurteilen. Das ist für viele bereits eine Provokation, weil sie über ihr eigenes Klischee nachdenken müssen. Das tut niemand gerne.
BRUNO MOLL: Vermutlich hat sich auch etwas entwickelt in den letzten Jahren, denn als ich mit Samba lento herauskam, der ja vergleichbar ist mit deinem Film, da waren die Reaktionen auch auf dieses Milieu noch ausgesprochen heftig. Das hat doch mit einem differenzierteren Denken zu tun. Ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, den Film anders anzulegen, und wenn ich das jetzt schildere, so werden viele sagen: Wau! hättest du das doch gemacht, das wäre ja wahnsinnig spannend. Es gibt in dieser Familie einen etwa fünfzigjährigen Debilen, der eigentlich hätte Nachfolger werden müssen in der Bally-Dynastie, weil er der einzige männliche Erbe war. Er ist ein begnadeter Musiker mit einem absoluten Musikgehör, ein begnadeter Bastler im Sinne der Frühmechanik, der in einer verrückten Villa lebt, umgeben von einem Berg von Extravaganzen. Da hätte sich ein Staunen, ein Ah und Oh am andern präsentieren lassen. Der Gedanke liegt nahe, dass man auf der einen Seite die Welt jenes Mannes, der das Weltunternehmen hätte übernehmen sollen, hätte porträtieren können, und auf der anderen Seite jenen, der es nun effektiv führt. Das wäre ein wunderbarer Film, schnelles Konzept, schnell realisierbar, diskussionslos akzeptiert vom Publikum, denn der Star des Abends wäre ja der Debile, der sich in einer totalen Phantasiewelt sogenannt selber verwirklicht – die Schienen liegen bereit, weil das mit der Realität nichts zu tun hat, man braucht blass darauf abzufahren –, und den, der seine Machtstrategien entwirft, den hätte man rasch abstreichen können. Übers Unternehmertum hätte ich damit nichts gesagt. Ich werfe jenen Leuten, die den Film in dieser Beziehung kritisieren, vor, dass sie sich nie mit ihren Gegnern auseinandergesetzt haben. Wer das nicht macht, wird nie dahinterkommen, weshalb das System überhaupt funktioniert – und es funktioniert.

(Bild: Der Schuh des Patriarchen)
FILMBULLETIN: Ich möchte auf zwei wichtige Elemente eurer Filmarbeit zurückkommen, auf die Kamera und die Montage. Es gibt in Reisen ins Landesinnere drei grossartige Travellings an der Landepiste des Flughafens Kloten. Es gibt im Schuh des Patriarchen Schwenks und Fahrten in der Fabrik, das Travelling entlang der Arbeitsplätze, wo durch die leise eingespielte fremdländische Musik so etwas wie Identitäten der Arbeiter aufschimmern. Wieweit lässt sich die Kamera planen, wieweit muss sie spontan reagieren?
MATTHIAS VON GUNTEN: Ich setze alles daran, dass ich das sehen kann, was ich sehen will. Du musst dich zuerst einmal vorbereiten; Bilder entstehen über ganz verschiedene Stufen. Die erste ist jene, in der du die Leute kennenlernst, du lernst langsam ihre Bewegungen, ihre Räume, ihren Alltag kennen. Dabei ergeben sich für dich schon die ersten Bilder. Dann geht es aufs Drehen zu, du gehst mit dem Kameramann zu den Personen und besprichst, was du in etwa vorhast. Ab diesem Zeitpunkt wird der Kameramann mit seinen Ideen und seinem Bildgefühl sehr wichtig. Die Bilder entstehen nun aus einem permanenten Dialog mit ihm heraus. Nun kommt auch die konkrete Entscheidung, wie du deine Dreharbeiten aufteilst, was du zu welchem Zeitpunkt wo drehen willst. Das verdichtet sich immer mehr, wobei man mit Bildern im Kopf an den Drehort kommt. Sie werden meist nicht genau so realisiert, aber sie sind das Ausgangsmaterial. Die Fahrt beispielsweise am Flughafen war ein alter Traum von mir, seit ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich hatte nicht geglaubt, dass es möglich wäre, weil ich dachte, die Leute würden merken, was mit ihnen passiert, was sie darstellen, wie man ihnen praktisch in ihre Geschichten hineinblickt, wie ich nicht möchte, dass jemand bei mir reinschaut. Sie fanden das toll.
FILMBULLETIN: Sind diese Travellings denn inszeniert?
MATTHIAS VON GUNTEN: Es ist eine Mischung. Das sind alles Leute, die da waren, sie mussten alle mit ihren Autos einen halben Meter zurückfahren, was einigen Unmut auslöste. Einige konnten nicht dorthin stehen, wo sie gewohnheitsmässig stehen, was wiederum Ärger gab. Natürlich haben wir auch etwas nachgeholfen, indem wir den einen da den anderen dort postierten und jene aussuchten, die wir an bestimmten Stellen haben wollten, aber ich hätte diesen Leuten nicht sagen können, sie sollten etwas tun, was sie sonst nicht machen. Da liegt die Grenze der Inszenierung, der Spielraum ist klein, indem du im Rahmen dessen, was sich ohnehin abspielt, gestaltend einzugreifen versuchst. Wir haben mit den vorhandenen Leuten jenes Bild geschaffen, von dem wir das Gefühl hatten, es wäre gut.
BRUNO MOLL: Auf mich hat das so schön inszeniert gewirkt, dass du vermutlich allen gesagt hast, ihr könnt tun, was ihr wollt, ihr dürft nur nicht in die Kamera hinein schauen. Das löst bei vielen Leuten immer wieder aus, dass sie eine bestimmte Position einnehmen und sich darin ruhig verhalten.
MATTHIAS VON GUNTEN: Sie sind wirklich so. Für mich ist die ganze Flughafengeschichte das statische Gegenelement zum Rest, wo immer alles im Fluss ist. Es ist sowohl im optischen Sinn statisch – nur die Flieger bewegen sich – als auch im psychischen Sinn. Da gibt es während dem ganzen Jahr keine Veränderung. Das ist für mich der Exzess der Ereignislosigkeit.
FILMBULLETIN: Es ist darüber hinaus die einzige Episode, die für Freizeit steht ...
BRUNO MOLL: ... zuschauen, Fernsehen oder Flugzeuge ...
MATTHIAS VON GUNTEN: ... es ist schwierig, etwas mit sich anzufangen, wenn man nicht muss.

FILMBULLETIN: Spielt im Schuh des Patriarchen für die inszenierten Teile eigentlich bestehendes Fotomaterial eine Rolle?
BRUNO MOLL: Nein, es existiert praktisch kein Fotomaterial, und ich habe eine starke Stilisierung versucht. Ich denke, wie Matthias, dass man keinen Film anfangen kann, wenn man nicht seine Bilder im Kopf hat, sonst ist man Reporter oder so was. Der Raum, in dem du etwas aufnimmst, gehört für mich zum Wesentlichen. Da gehe ich vorher hin und schaue mir Raum und Licht an, betrachte Gegenstände und stelle mir die Figur in einer Beziehung dazu vor. Das ergibt für mich bereits den fertigmontierten Film. In diesem Sinn inszeniere ich auch wirklich alles, alles. Es gibt ganz selten irgend eine Zufälligkeit. Es kann mehr oder weniger gut herauskommen, das Licht, eine Kamerabewegung, das Timing, weil das Wiederholen den, der etwas darstellen sollte, nervös gemacht hat. Ich lasse höchstens in den vorwegdefinierten Räumen Freiheit. In Das ganze Leben geschah das ja mehrmals, dass die Barbara und die Schauspielerin aufeinander reagierten, aber der Raum, in dem sie sich dabei bewegen konnten, war absolut bestimmt. Das Licht muss dazu richtig gesetzt werden, die Absprache mit der Kamera, welche Grössen, welche Ausschnitte, welche Elemente in einer zu drehenden Einstellung drin sein müssen, alles ist vorwegbestimmt. Ich kann das nicht anders machen, weil ich sehr stark auf die Montage hin arbeite, den Film bereits im Kopf habe.
FILMBULLETIN: Du hast aber auch schon deine Mühe mit den festen Strukturen bekundet, dass du spontaner arbeiten möchtest und nicht unzählige Drehbuchfassungen für einen Dokumentarfilm herstellen möchtest, weil das nicht aufgehe.
BRUNO MOLL: Ich habe mich sicher so geäussert, aber ich bin davon weggekommen. Die Nähe zu den Dingen erreiche ich nicht über cinerna verite, indem ich in einen Raum hineinkomme und mit der Kamera wild herumpirsche. Ich bin inzwischen überzeugt, dass es ein Trugschluss ist zu glauben, das Leben springe dich nur so an, wenn du nahe genug rangehst. Diese Methode kann ihre Richtigkeit haben, wenn ich beispielsweise nach Nicaragua reise, in einem Dorf etwas drehe und dann taucht im Hintergrund plötzlich ein Panzer auf. Ich kann das mit aufnehmen, vielleicht eskaliert dann alles und es ist im Kasten. Aber das ist nicht das, was ich hier als Realisator mache. Für einen Kameramann mag das reizvoll sein.
MATTHIAS VON GUNTEN: Ich finde, es ist beides. Ich könnte auch nicht ohne die Bilder, die ich im Kopf habe, arbeiten. Andererseits möchte ich auch nicht ohne die Zufälligkeiten am Ort auskommen. Die gute Vorbereitung ist die Basis, um am Drehort mit einer gewissen Offenheit umzugehen. Du musst für sie bereit sein. Bei Catherine im Fernsehstudio zum Beispiel, da wussten wir nie, was passieren würde, wir wussten nicht, wann es losgehen konnte, und wenn es losging, so wussten wir nicht, ob es interessant sein würde. Da gab es absolut keine Steuerungsmöglichkeit. Wir wussten lediglich, mit welchen Bildern wir ihr begegnen wollten, als Basis für Sprünge ins leere.
FILMBULLETIN: Bei der Kameraarbeit haben die Porträtierten noch eine gewisse Mitsprachemöglichkeit, sofern sie ein Bewusstsein um die Möglichkeiten ihres Einsatzes haben. Bei der Montage nachher sind sie ausgeschlossen. Wieweit war beispielsweise das Konzept bei den Reisen ins Landesinnere vorwegbestimmt?
MATTHIAS VON GUNTEN: Das war vorausgedacht in dem Sinn, dass ich zwar nicht wusste, wie es im Einzelnen herauskommen konnte, aber mir war klar, wie der fertige Film funktionieren würde, mit diesen Fragmenten, die sich ergänzen, fortsetzen, kommentieren. Im Hinblick auf den Schnitt gab es klare Vorstellungen über die einzelnen Szenen, sie mussten rasch verständlich sein, durften keine lange Einstiegszeit erfordern, und sie mussten einen Fluss, eine Bewegung haben. Andererseits musste sich aus dem Material eine interessante Geschichte ergeben, sonst würde man die neunzig Minuten nicht durchstehen. Es war auch so, dass wir optisch nahe bei den Leuten sein mussten. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer Totalen bei jemandem zu beginnen. In diesem Sinne haben wir gedreht, in diesem Sinne war die Montage vorbereitet. Dass sie schliesslich sehr viel schwieriger wurde, als wir es uns gedacht hatten, ist eine andere Geschichte. Ich hatte den Anspruch, aus dem Film etwas Ganzes, zusammenhängendes zu formen. Die Schwierigkeit war, aus dem vielen unterschiedlichen Material einen einheitlichen Fluss zu erzeugen. Man kam zwar jemandem nahe, aber die Wechsel zu einer anderen Person funktionierten anfänglich nicht. Es entstand ein Unterbruch, der Film ging nicht weiter. Dazu kam die Schwierigkeit der Auswahl jenes schmalen Ausschnittes, der einerseits die Person intensiv und spürbar macht und andererseits nicht zu lang wird. Gleichzeitig muss er mit dem restlichen Material zusammen funktionieren.
(Bild: Reisen ins Landesinnere)
Das war eine permanente, teils verzweifelte Suche. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass der Film im Endeffekt funktioniert, dass sich die ver schiedenen Leute darin nicht stören, sondern gemeinsam etwas Spannendes erzeugen würden. Die Montage hat schliesslich zehn Monate gedauert. Dabei haben Freunde mit ihrer Kritik und Bernhard Lehner als Cutter sehr viel dazu beigetragen, den Film, so wie er jetzt ist, aus dem Material auszugraben.
FILMBULLETIN: Was hat Georg Janett zum Schuh des Patriarchen beigetragen?
BRUNO MOLL: Er hat mich gelehrt, ganze Sätze zu machen, weil ich dazu neige, mit Fragmentierungen zu spielen, so dass es für die Zuschauer noch komplizierter, noch verschlüsselter wird. Er hat Ruhe in den Film gebracht, er hat mir geholfen, die Sache zu vereinfachen. Im übrigen war klar, dass es eine schwierige Materie war und dass man sich überlegen musste, ob es nicht gescheiter wäre, ein Buch zu schreiben über diesen Stoff. Die Struktur des Filmes war andererseits von Anfang an klar; wir konnten spielen mit den drei verschiedenen Ebenen. Die Linearität der Erzählung andererseits entspringt seiner Idee, weil er die Ansicht vertritt, dass ein ohnehin schon komplizierter Stoff nicht durch komplizierte Strukturen noch erschwert werden soll.
MATTHIAS VON GUNTEN: Der Zuschauer würde auch bei einer komplizierteren Struktur noch mitmachen, wenn die Intuition stimmt. Als es bei unserem Projekt um die Finanzierung ging, haben verschiedene Leute gesagt: Das Konzept ist ausgesprochen interessant, nur, es geht niemals auf, das lässt sich nicht realisieren. Im Prinzip widerspricht die Montage, die wir haben, auch fast allen Regeln. Da sind permanente Brüche, die sich nicht unbedingt aufdrängen. Natürlich glaubte ich hundertprozentig dran, nur: Wir haben rein intuitiv geschnitten. Wenn wir etwas angeschaut haben, um zu sehen, ob es aufgeht, so ging es hundertmal nicht, und auf einmal hatten wir die Lösung. Über das Warum waren wir uns nie im klaren. Kein Schnitt liess sich auf den anderen übertragen. Wir hatten immer das Gefühl: Jetzt haben wir das System raus, wie wir schneiden können. Haben wir es auf den nächsten Schnitt angewandt, so ging es bereits nicht mehr auf. Jeder Schnitt hat eine andere Logik. Ich glaube, wenn man sich die Freiheit nimmt, eigene Räume zu erzeugen mit den Bildern, eine eigene Unlogik zu verfolgen, und wenn sich daraus für die menschliche Wahrnehmung etwas ergibt, das aufzunehmen ist, so ist der Zuschauer zu sehr viel bereit – er will blass nicht den Anschluss verlieren. Im Schweizer Film geht da vieles zu brav ab, gerade wenn man vergleicht mit anderen. Ein Solanas oder ein Chris. Marker beispielsweise reiht problemlos die unterschiedlichsten Dinge aneinander; aber weil es zuinnerst stimmt, nimmst du alles auf und hast gar keine Probleme. Da liegt ein riesiges Potential brach für uns.
BRUNO MOLL: Das stimmt schon, nur engst du damit, je mehr du von den Strukturen des Filmes her verlangst, auch das Publikumspotential immer mehr ein. Und das scheint mir bei allem auch zunehmend eine wichtige Überlegung. Wer schaut sich meine Filme an? Wieviele Leute schauen sich meine Filme an? Georg Janett hat bei meinem Film die Zugänglichkeit zum Stoff erleichtert.
FILMBULLETIN: Das läuft auf die Frage raus, welche Funktion Dokumentarfilme heute noch haben können, in einer Zeit, da sie es im Kino schwerer denn je haben. Und damit verbunden auch die Frage, wie man formal vorgehen kann. Bruno nennt seinen Film Essay – gilt es also auch, neue Wege zu beschreiten, um sich noch stärker von den eigentlichen Fernseharbeiten abzugrenzen?
BRUNO MOLL: Ich kann sagen, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe, noch solche Filme zu machen. Ich sehe den Sinn nicht mehr ein, weil das Publikum im Kino so geschrumpft ist auf ein letztes Häuflein von Leuten, die sich solche Filme noch anschauen, was auf der anderen Seite auch ein grosses Mass an Subventionierung bedingt. Die Kinos spielen auch nicht mehr recht mit. Der Aufwand, den man betreibt, die Arbeit, die man in solche Filme investiert, da ist für mich klar, dass solche Filme nur noch unter ganz massiver Beteiligung des Fernsehens entstehen können, das heisst: ganz anders als jetzt.
MATTHIAS VON GUNTEN: Ich könnte etwas Ähnliches sagen, möchte es aber nicht als Resignation sehen. Ich möchte im Moment auch keinen weiteren Film dieser Art machen, und dennoch war es für mich lebenswichtig, ihn zu realisieren. Ich glaube auch, dass der Film für viele etwas aussagt und dass ihn 5 000 Leute sehen werden.
BRUNO MOLL: Das ganze Leben hatte etwas zwischen 12 000 und 15 000 Zuschauern, das ist schön, aber nicht viel.
FILMBULLETIN: Die Filme werden anschliessend auch im Fernsehen gezeigt und verzeichnen dort ein Vielfaches der Zuschauerzahlen. Gibst du nicht zu einfach das Kino auf?
BRUNO MOLL: Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Filme dieser Art ihre Funktion haben, nur scheint mir, dass der Hauptnutzniesser das Fernsehen ist, wo je nach Programmierung 100 000, 200 000, 300 000 Leute sie sehen. Das ist viel, und das legitimiert einen solchen Film auch wieder. Wenn ich aber die Rechnung mache und feststelle, dass das Fernsehen blass zu einem Fünftel beteiligt ist, dann geht etwas nicht auf. Ich sehe nicht ein, weshalb unsere Kulturgelder für Fernsehprogramme verschleudert werden. In meinem Fall ist das Fernsehen begeistert von meinem Film. Sie sagen mir, sie würden so etwas in ihren Strukturen nie zustandebringen. Wenn ich aber sage, mein Film hat 350 000 Franken gekostet, das Fernsehen könnte sagen wir 250 000 daran beteiligen (was sie bei Spielfilmen machen), dann liesse ich wieder mit mir reden.
MATTHIAS VON GUNTEN: Für mich gibt es schon noch einen anderen Ansatz. Man macht Filme sicher für ein Publikum; ohne daran zu denken, dass ein Film auch gesehen wird, ist es läppisch, Filme zu machen. Ein anderer Gesichtspunkt aber ist doch, dass du eine Idee realisieren willst. Es gibt auch den künstlerischen Prozess. Ein Film hat für dich ja auch eine künstlerische Wichtigkeit. Wenn sich bei dir eine Idee manifestiert, so kannst du dich nur entscheiden, sie abzutöten oder sie umzusetzen. Die Umsetzung allein hat für sich aber einen Wert und stellt auch ein irrsinnig tolles Erlebnis dar. Ich würde es wichtig finden, wenn man die Unterscheidung Dokumentarfilm – Spielfilm einmal aufheben könnte. Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte einen Dokumentarfilm realisiert. Er wird in dieser Kategorie gezeigt, weil es sie nun einmal gibt. An sich habe ich kein Verhältnis zum Dokumentarfilm. Für mich steckt in diesem Film etwas ganz anderes, der Umgang mit Bildern, mit Situationen, das Erzeugen eines Gesamtbildes, der Versuch, Bildern aus meinem eigenen Land zu begegnen. Dass das mit dokumentarischen Mitteln passiert, ist für mich zweit- oder drittrangig. Die Unterschiede müssen kleiner gemacht werden. Das Kriterium müsste doch einzig sein: Welche Filme sagen uns etwas. Man muss erreichen, dass jene Filme, die drängen, entstehen können.
Mit Matthias von Gunten und Bruno Moll unterhielt sich Walter Ruggle
(Titelbild: Reisen ins Landesinnere)




