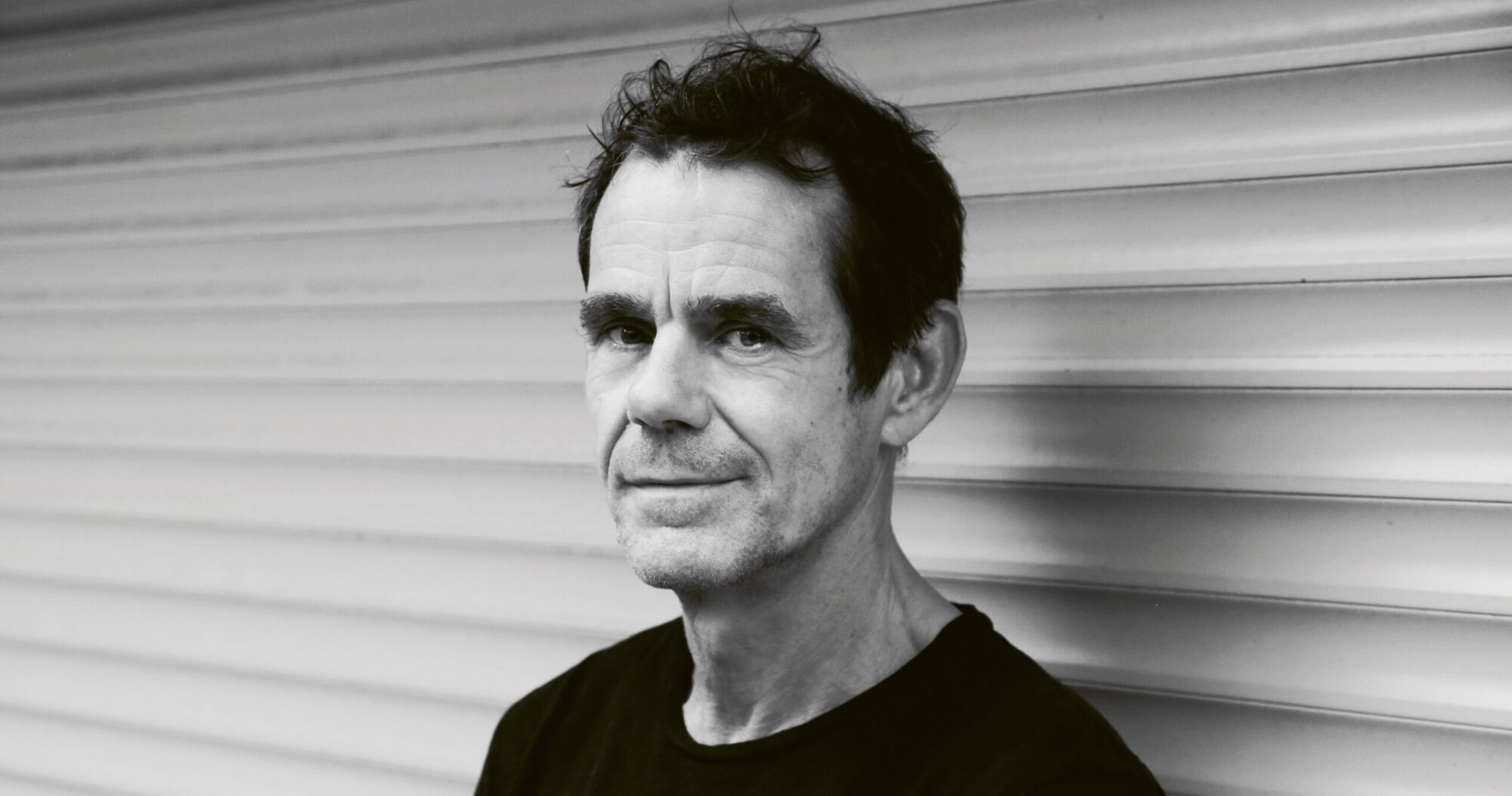Nach dem Kollektivfilm Children of Srikandi (2012) und Le Goût de l’espoir (2019) ist Sedimente für Sie der erste Film, der einen sehr engen persönlichen Bezug zu Ihnen hat. Sind Sie dabei anders vorgegangen als bei anderen Filmen?
Ich bin Anthropologin und interessiere mich für die Geschichten anderer Menschen. Dadurch, dass die politische Situation in Deutschland so ist, wie sie momentan ist, mit einem immer stärker werdenden Rechtspopulismus, dachte ich, ich muss anfangen, in meine eigene Geschichte zu schauen. Die Distanz aus der Schweiz hat mir dabei sehr geholfen, weil dieser Blick von aussen so wichtig ist. Thomas Heise, einer der wichtigsten deutschen Dokumentarfilmemacher, der leider letztes Jahr verstorben ist, hat seinen Studierenden immer gesagt: «Bitte macht nicht als ersten Film einen Film über eure Familie.» Man muss erst in der Auseinandersetzung mit anderen Themen lernen, eine eigene Position zu entwickeln, damit man erkennen kann, in welchen Momenten man als Regisseurin agieren muss und wann nicht. Ohne diesen inneren Kompass kann es richtig in die Hose gehen und der Film zur Familienpropaganda werden. Das hatte ich immer im Hinterkopf. Dieses Bewusstsein für Nähe und Distanz und die akribische Archivarbeit, die ich vom wissenschaftlichen Arbeiten kenne, haben mir bei diesem Film sehr geholfen. Zudem finde ich es wichtig, bei einem so persönlichen Film nicht allein zu arbeiten – insbesondere nicht bei der Montage. Man kann sich sonst sehr schnell verirren und den Blick für das Wesentliche verlieren. Eine zentrale Frage für meine Co-Editorin Kathrin Schmid und mich war: Was ist zu persönlich – und was besitzt universelle Gültigkeit?
Sie haben in einem Q&A erwähnt, dass Sie versuchten, mit dem Rollenkonflikt Enkelin/Autorin umzugehen, indem Sie mit der statischen Kamera Distanz schafften. Wie sind Sie dabei konkret vorgegangen?
Ich glaube die Frage der Enkelin versus Regisseurin zieht sich durchs ganze Projekt. Es war eine fortwährende innere Auseinandersetzung, eine angemessene Balance zu finden. Die fixe Kamera bedeutete für mich: ich bin distanziert, ich bin die Filmemacherin. Ich hätte auch mit einer Handkamera sehr nahe rangehen können und habe dann aber gemerkt, dass ich diese Distanz brauche. Zwischendurch war ich auch wieder Enkelin, wenn ich gemerkt habe, dass mein Grossvater müde wird und wir aufhören müssen. Ich thematisiere das auch am Ende des Films: Wenn ich nur Regisseurin gewesen wäre, hätte ich in bestimmten Momenten radikaler insistiert und nachgefragt.

Laura Coppens / © Ellen O’Connell
Geht es dabei auch um die Dimension der Bewertung? Der Bewertung des Lebens eines Mannes, der auch der Grossvater ist?
In Deutschland dominiert – insbesondere im Hinblick auf die DDR-Geschichte – ein stark polarisierter Diskurs, geprägt von Schwarzweiss-Denken. Das war für mich besonders am Anfang des Projekts sehr schwierig. Die bei der Stasi sind immer die Bösen und die Opferstimmen bekommen – berechtigterweise – viel Platz. Mir fehlt da ein Graubereich. Ich denke, wir müssen gerade jetzt erst einmal genau zuhören, um diesen Graubereich auszuloten. Das ist für ein Verständnis und ein Lernen aus der Vergangenheit notwendig. Gerade weil das Thema alle ostdeutschen Familien betrifft, wollte ich aufzeigen, wie ich damit umgehe und wie schwierig es ist, die richtige Balance zu finden. Wir kennen aus der Aufarbeitung des Dritten Reichs den Begriff der «guiltless guilt»: Das bedeutet, dass die Enkel:innengeneration ihre Grosseltern möglichst positiv darstellen will, um der eigenen familiären Verstrickung nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Auch das Konzept der «reflektierten Zeug:innenschaft», dass ich die Zeugenschaft meines Opa aufzeichne und dann damit reflektiert umgehe, war für mich wichtig.
Kann ich das so verstehen, dass Ihre Aufgabe zuerst das Zuhören und Aufzeichnen war und der Film der Umgang damit?
Es gibt zwei Ebenen. Das Zuhören war von Anfang an eine filmische Entscheidung. Das Bildformat ist 4:3, man ist nicht abgelenkt von der Umgebung, wir gucken den Protagonisten an und müssen bei ihm bleiben, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind gezwungen, zuzuhören, bevor wir ein Urteil fällen. Das war mir wichtig. Im Schnitt kam dann die reflektierende Ebene dazu. Da gibt es diese Szene, wo es um die Kindheit meines Grossvaters in Nazideutschland geht. Da erzählt er eine Erinnerung an KZ-Häftlinge im Wald und ist sehr distanziert. Dem stelle ich seine Erinnerung an den Tod seines Vaters und seines Bruders gegenüber.

Sedimente / © Visions du Réel/Srikandi Films
Bei diesen zwei Sequenzen sieht man ihn nicht sprechen, stattdessen sieht man Aufnahmen aus einem Wald. Es gibt diesen einen Moment, wo seine Stimme bricht: Da hätte es mich als Zuschauerin interessiert, zu sehen, ob das an seinem Alter lag oder ob es emotionale Gründe hatte. War es eine bewusste Entscheidung, ihn dort nicht zu zeigen?
Er war da tatsächlich sehr emotional. Diese Emotionalität bezog sich aber nicht auf die KZ-Häftlinge, sondern darauf, dass die Menschen im Dorf Mitleid mit ihnen hatten. Das fand ich sehr auffallend und auch irritierend. Ich habe bewusst entschieden, dass man ihn in dieser Szene nicht sieht. Ich wollte ihm diesen Raum nicht geben. Ich wollte die Opfer nicht kleiner machen. Also habe ich die beiden Szenen bewusst gegeneinandergestellt. Erst später sitzt er wieder im Sessel und spricht über das Kriegsende, und da habe ich ihm wieder Platz gegeben. Ich wollte die beiden Szenen gegenüberstellen, weil sie sehr typisch sind für das deutsche Erinnern: ein sehr kalter Umgang mit den Opfern und ein sehr emotionaler Umgang mit der eigenen Opferhaltung, der Selbststilisierung als Opfer.
Ich würde gerne noch auf die Szene eingehen, wo Ihr Grossvater Sie fragt, ob er sich anders verhalten und den Bericht an die Stasi nicht hätte schreiben sollen. Im Film ist keine Antwort zu hören. War da eine Antwort?
Ich habe mich entschieden, diese zentrale Frage meines Grossvaters erst am Ende des Films aufzunehmen. Da der Film mit einem Brief meiner Grosseltern an mich beginnt, entschied ich mich, am Ende einen posthumen Brief an meinen Opa zu schreiben, in dem ich das Thema nochmals aufgreife und die Thematik des Schweigens in unserer Familie auf eine gesellschaftliche und universelle Ebene bringe. Während der Gespräche mit ihm war diese Situation eine der sehr schwierigen. Genau deshalb sagt sie auch so viel über die stattfindende oder eben auch nicht stattfindende Auseinandersetzung innerhalb von Familien aus. Ich war überrascht, als er mich danach fragte, ob er anders hätte handeln sollen, und ich empfand eine grosse Verunsicherung, weil ich ihn nicht verletzen wollte.
Im Film kommt fast keine Musik vor. Warum?
Ich bin diesbezüglich eher minimalistisch unterwegs. Es gibt nur dreimal Musik, und auch immer Musik aus der jeweiligen Zeit und aus einem bewussten inhaltlichen Impuls heraus. Ansonsten gibt es keine untermalende Musik, denn ich wollte nicht emotionalisieren. Ich wollte die Zuschauenden selbst in die Verantwortung nehmen, zu reflektieren. Es ist schliesslich nicht nur meine Familiengeschichte, auch in der Schweiz betrifft das viele Familien. Dieses Schweigen ist universell.
Junge Kritik
Dieses Interview entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) am Dokumentarfilmfestival Visions du Réel 2025 in Nyon.