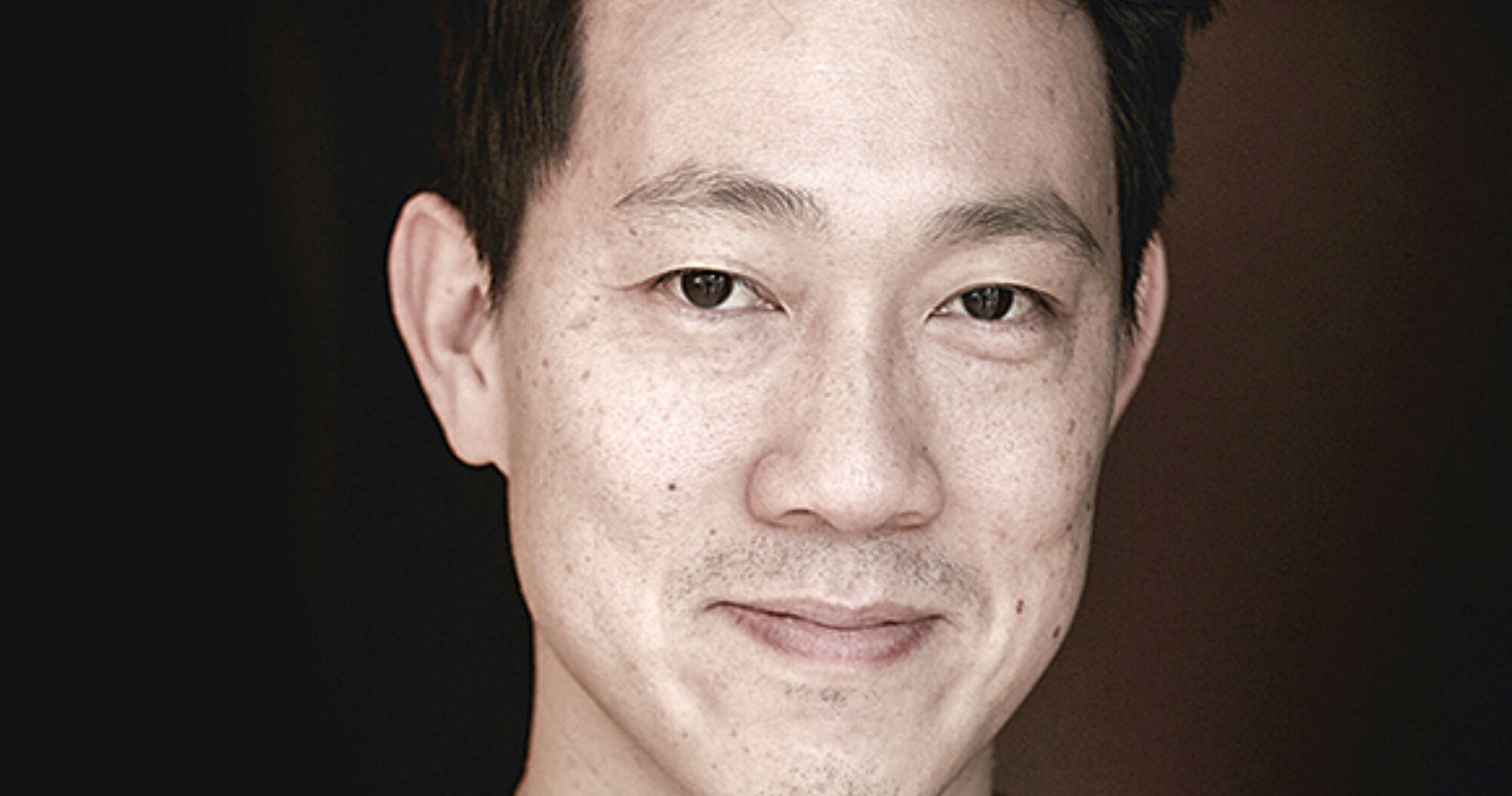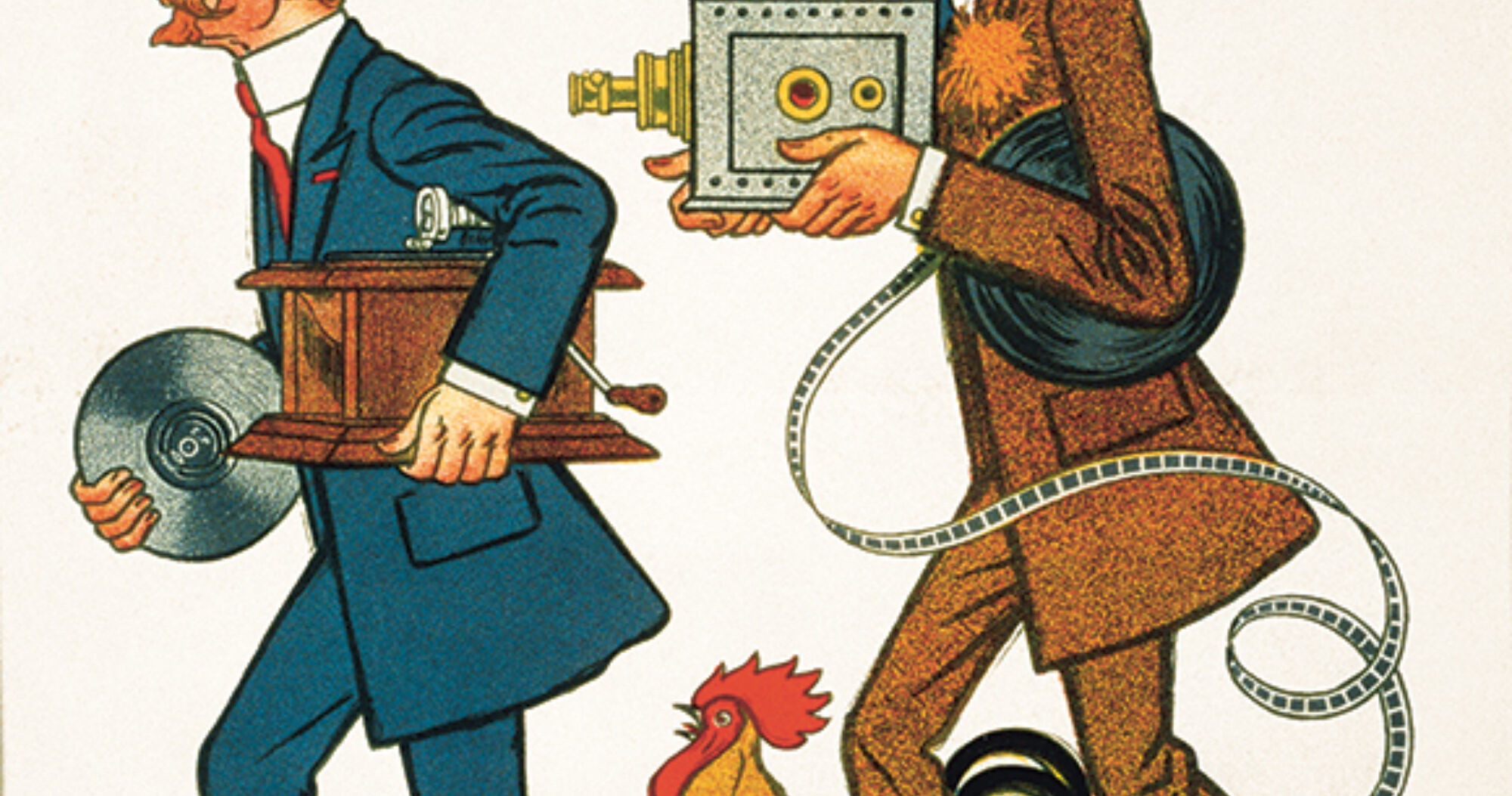Vor ungefähr zwanzig Jahren lief in Moskau in einer Woche des Schweizer Films auch La Paloma, der das russische Publikum erstmals mit Daniel Schmid bekanntmachte. Wenn man La Paloma heute wieder anschaut, versteht man, warum sich der Regisseur gerade mit diesem Film einen europäischen Namen schuf. In den siebziger Jahren fand ein radikaler Wertewandel statt. Nach den revolutionären Unruhen im Mai 68 und dem Ausverkauf der Illusionen (Kuba, China, Prager Frühling) besann sich die europäische Welt auf ihren Selbsterhaltungstrieb, kapselte sich ab und wandte sich ihren eigenen Bedürfnissen zu. Die Massenmedien kultivierten die Gewohnheit, Realität mit «geschlossenen Augen» zu betrachten, und die Kultur begann mit offenkundigem Genuss, ihre Vergangenheit durchzukauen.
La Paloma ist durchdrungen vom Gefühl der totalen (und fatalen) Abkapselung. Die Handlung entspinnt sich in der Atmosphäre von Cabaret und Casino, wo unter anderen mit sowjetischen Rubeln gespielt wird. Das Spiel ist aber schon lange vorbei, es gibt nur noch seine Imitation, seine Simulation. Eine an Tuberkulose erkrankte Cabaret-Sängerin bricht ihrem reichen Verehrer das Herz. Er trägt sie auf Händen, überredet sie, seine Frau zu werden, sie aber betrügt ihn bei jeder Gelegenheit. Drei Jahre nach Palomas Tod wird, wie sie es im Testament bestimmt hat, ihre Leiche exhumiert. Und nicht von irgendwem, sondern von ihrem Mann und ihrem Liebhaber, wobei der erstere den wunderschönen Leib in Stücke hackt, endgültig den Verstand verliert und ins Casino zurückläuft.

(Bild: La Paloma)
Es braucht Mut, sich einem solchen Sujet zuzuwenden, besonders wenn es ohne jede ironische Brechung präsentiert wird. Die Verfremdung bleibt auch in der Szene aus, in der Paloma und ihr Verehrer vor dem Hintergrund der Alpenlandschaft ein Duett aus einer Operette singen und in den Wolken Eros wie ein Hermaphrodit schwebt. Nicht, dass es hier überhaupt keine Ironie gäbe, aber diese ist nicht die Ironie des Regisseurs, sie liegt vielmehr in den touristischen Schönheiten der Schweiz, die hier beinahe in den reinen Kitsch ausarten. Das, was Realität zu sein vorgibt, ist in Wahrheit künstlich, surreal und konstruiert. Heute sind solche Feststellungen nicht mehr erstaunlich. Aber La Paloma wurde bereits 1974 gedreht, und zu der Zeit galten dekorative Theatralik und barocke Künstlichkeit nicht als zentrale Gestaltungsmittel der Kinokultur, obwohl sie bereits merklich den dokumentarischen Filmstil der sechziger Jahre verdrängten, der sich durch seine Ähnlichkeit mit dem «verachtenswerten» Fernsehen kompromittiert hatte. Der hochbetagte Buñuel versprach mit beissendem Spott, er werde für einen Augenblick aus dem Grab erstehen, um den Ausgang der Episode einer Fernsehserie zu erfahren. Mit Bulle Ogier, die kurz zuvor in Le charme discret de la bourgeoisie gespielt hatte, setzte Schmid auch in La Paloma einen Buñuel-Akzent.
Schmid war die ideale Person, den unbehaglichen Zustand der europäischen Kultur, eingespannt zwischen Archaik der alten und Vulgarität der neuen Rituale, zwischen der klassischen Oper und der Seifenoper, zum Ausdruck zu bringen. Seine Herkunft kam ihm dabei zugute. Er wurde in den Bergen geboren und ist dort aufgewachsen, wo die Flüsse von den Alpen nach Norden und nach Süden fliessen, wo die auf der Karte nicht vermerkte Grenze zwischen der lateinischen und der germanischen Welt verläuft, wo Schmuggler und Drogendealer ihre Pfade haben. Schmid ist denn auch der Überzeugung, dass der Regisseur den Schmugglern, diesen professionellen Abenteurern, verwandt ist: er übersetzt Wirklichkeit in Träume, ist Kosmopolit, überall zu Hause und überall ein bisschen fremd.

(Bild: La Paloma)
Mit Fassbinder verband den jungen Daniel Schmid eine freundschaftliche Beziehung. Beide traten in Filmen des jeweils anderen als Schauspieler auf, und Schmid setzte Fassbinders Stück «Der Müll, die Stadt und der Tod», das in Deutschland wegen «Verdachts auf Antisemitismus» verboten war, unter dem Titel Schatten der Engel für die Leinwand um. Gemeinsam machten sie die Aufnahmeprüfung für die Berliner Filmhochschule. Auf Drängen von Fassbinder, der nicht aufgenommen wurde, verliess der «verwöhnte Schweizer» die Schule aber wieder. Während Fassbinder eine «grossartige Randfigur» der deutschen Gesellschaft war, «ihr eigen Fleisch und Blut», fand Schmid seine Wurzeln problemlos überall in Europa.
Für Schmid, der in Zürich lebt, in Deutschland wie in Frankreich arbeitet, auch einige Filme auf italienisch gedreht hat und fliessend englisch spricht, stellt sich die europäische Kultur selbstverständlich als ein grosses Ganzes dar. Als Regisseur vertritt er auch vehement die These, dass man für die Erhaltung des Regionalen, des Europäischen – und gegen das amerikanische brainwashing – kämpfen muss. Im eigenen Werk ist er weit entfernt von allem Modischen, das immer an das Banale, Abgeschmackte grenzt. Es ist ihm nicht wichtig, ob die Politiker Russland für einen Teil Europas halten. In Moskau besuchte er das Tschechow-Haus und fand gerade dort die Bestätigung, dass er, Daniel Schmid, Europäer ist. Gemeinsame kulturelle Gene. Dafür bemerkte er bei der Aufführung von Rimski-Korsakows «Die Zarenbraut», die russische Oper sei zu Zeiten Iwans des Schrecklichen steckengeblieben.
Was ist die Oper für Schmid? Eine einstmals grosse europäische Kunst, die heute – wie die wunderbaren Greise in seinem Film Il bacio di Tosca – mehr tot als lebendig ist. Eine Kunst, die dem neunzehnten Jahrhundert verhaftet ist. Wird das Kino seinerseits dem zwanzigsten Jahrhundert verhaftet bleiben, ist es nicht heute schon mehr tot als lebendig?
Ja und nein, antwortet Daniel Schmid. Und wenn nur ein einziges Prozent «nein» zutreffen sollte, dann nicht etwa deshalb, weil das Kino eine grosse Kunst ist, sondern deshalb, weil es ein Kommunikationsmittel geschaffen hat, das nur ihm zu eigen ist. Im Kino sind wir einem ganz bestimmten Ritual des Begehrens unterworfen: Es gibt Eis, es ist hell, man sitzt neben unbekannten Leuten, dann erlischt das Licht, und wie diese Unbekannten erwartet man, etwas Wunderbares zu erleben. Auf der Leinwand. Oder im Leben.

(Bild: Bacio di Tosca)
Das war einmal. Doch die Bedingungen, unter denen der menschliche Kopf arbeitet – wenn er denn überhaupt arbeitet – haben sich geändert. Neunzig Prozent der Fernsehzuschauer, die in den Programmen herumzappen, sind nicht in der Lage, etwas für sie Brauchbares auszuwählen, ebensowenig wie im Supermarkt, und konsumieren schliesslich, was man ihnen aufschwatzt.
Der Überfluss an Informationen zwingt die Menschen zuzugeben, nichts zu wissen, nichts zu verstehen, nichts zu empfinden. Das Relief der Welt wird unscharf, unerklärbar, nicht greifbar.
Und doch bleibt Schmid verhalten optimistisch: «Solange die Menschen noch den Wunsch haben, in einem verdunkelten Raum gemeinsam zu träumen, wird das Kino bestehen bleiben. Vielleicht zwar nur an der Peripherie, wie die Kammermusik. Aber die Filme, die mich beschäftigen, die persönlichen Filme, und nicht die sogenannten grossen Filme, wird es weiterhin geben. Ich glaube, dass die Menschen einen Hang zu mythischen Formen und rätselhaften Bildern haben, zu atavistischen Märchen und magischen Symbolen, die sie zu den verschütteten Erinnerungen an ihre Kindheit und ihrer Kultur zurückführen. Ich glaube also, dass das Kino ein Mittel zur Flucht aus dem langweiligen Einerlei des Lebens und dem Verlust der Identität ist.»
Einer der «persönlichsten» Filme des Schweizer Regisseurs, Hécate (1982), hat vieles im europäischen Kino vorweggenommen. Auf den ersten Blick ist dieser Film überhaupt nicht typisch für Schmid: ein Kolonialroman, exotische Pleinairs als Hintergrund, der wunderliche Alltag in den arabischen Siedlungen, die vom Kino mythologisierten Begriffe «Marokko» und «Casablanca».
Verführung und Verhängnis – sie haben im Kino ihr eigenes Genre und den Typus der femme fatale hervorgebracht. Schmid verwendet gerne traditionelle Klischees, macht aber einen eher metaphysischen Film. Wie in keinem anderen Film ist es ihm hier gelungen, die fliessende, unbeständige Substanz von Zeit, Raum und Gefühl festzuhalten. Die Handlung beginnt und endet 1942, doch in dieser Zeitspanne liegt erstarrte sakrale Ewigkeit, das Kontinuum, die Endlosigkeit des Augenblicks. Der Ehemann der Heldin befindet sich auf einer geheimnisvollen Mission in Sibirien, und der eifersüchtige Liebhaber fährt dorthin, um dies zu überprüfen. Alles existiert wirklich: Sibirien (zwanzig Kilometer von Zürich entfernt gedreht), der Ehemann, der den Verstand verloren hat, und doch ist es klar, dass diese Geographie und diese Psychologie fiktiv sind, dass eine objektive Realität nicht existiert.

(Bild: Hécate)
Wie in La Paloma wird das Sujet durch die Leidenschaft des Mannes für eine Frau vorangetrieben, doch ist hier die Frau noch stärker mythologisiert, der biblischen Lilith oder der antiken Hecate gleich. Sie hat keinen eigenen Charakter, keine konkreten menschlichen Eigenschaften; sie dient als Objekt, auf das der Mann, ein Karrierediplomat, seine Begeisterung, seine Furcht und seinen zerstörerischen Instinkt projiziert. Hécate entstand zehn Jahre bevor Bertolucci den metaphysischen Charakter des arabischen Afrikas entdeckte und zeigte, wie dieser das Bewusstsein des oberflächlichen Touristen deformiert. Schmid ist dieser Entdeckung bereits ziemlich nahe: Er nimmt die Mittel vorweg, mit denen der Prozess der psychischen Wandlung, auch wenn dieser anders motiviert ist, fixiert werden kann. Er nimmt den Rhythmus und die Bewegung, die Kälte der stilistischen Entfremdung vieler berühmter Filme der achtziger und neunziger Jahre vorweg. Er nimmt auch die Hinwendung zum Exotischen vorweg – es ist kaum ein Zufall, dass der Film in Tanger gedreht wurde, dem «letzten Mikrokosmos» der englischen Kolonie, zu deren Mitgliedern auch Paul Bowles gehörte, dessen Roman «The Sheltering Sky» Bertolucci inspirierte.
Der hundertprozentige Europäer Schmid hatte Gelegenheit, in den unterschiedlichsten Ecken der Welt zu drehen, selbst in Japan. Und doch kehrte er mindestens einmal zum Haus seiner Kindheit und zu seiner Familiengeschichte zurück. Daraus entstand Hors saison (1992). Hier liess der Regisseur erstmals dem Strom persönlicher Emotionen freien Lauf, hier vertraute er vollkommen der sinnlichen Erinnerung, die an die plastische Imagination grenzt: «Es war – Es war nicht». Hier feiern Phantasie und Traum ein Fest, tanzen auf ihrem Ball. Die Menschen sind Gespenster, die von den Toten auferstanden sind und realer als die Lebenden aussehen. In Hors saison konnte Schmid das für ihn so vielschichtige Bild des Grand Hotel realisieren, das latent alle seine Werke inspiriert hat.
Schmids Familiengeschichte geht nicht zurück bis in die Ritterzeit, seine Wurzeln liegen näher bei uns und sind doch gleichzeitig unerreichbar fern. Wie gemütlich war Europa vor hundert Jahren, schon ausgestattet mit den Segnungen von Zivilisation und Komfort, aber noch unberührt vom totalitären Verderben. Das goldene Jahrhundert der Bourgeoisie war noch weit davon entfernt, sich mit Hilfe seines historischen Totengräbers – des Proletariats – selbst zu Grunde zu richten. Die Revolution schien eine romantische Sache zu sein, ein Nervenkitzel, geboren aus der übersättigten Langeweile in den aristokratischen Salons und elitären Cafés. Schmid fand noch Augenzeugen und untersuchte die Aktivitäten eines gewissen Wladimir Uljanow in Zürich. Er fand heraus, dass dieser pünktlich seine Miete gezahlt und bei den Anwohnern einen guten Eindruck hinterlassen hatte («Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört.»).
Erst kürzlich kam Daniel Schmid wieder nach Moskau, weil er damit beschäftig ist, einen Film über eine russische Prostituierte, die zur Göttin der Schweizer Kommunisten wird, vorzubereiten. Eine weitere Buñuel-Groteske.
Hier, in Moskau besuchte Schmid alle zentralen Metrostationen und war begeistert. Auf dem berühmten Vogelmarkt kaufte er eine Katze, die er Anton Tschechow nannte.
Andrej Plachow; aus dem Russischen übersetzt von Dorothea Trottenberg

(Titelbild: Daniel Schmid; letztes Bild: Das geschriebene Gesicht)