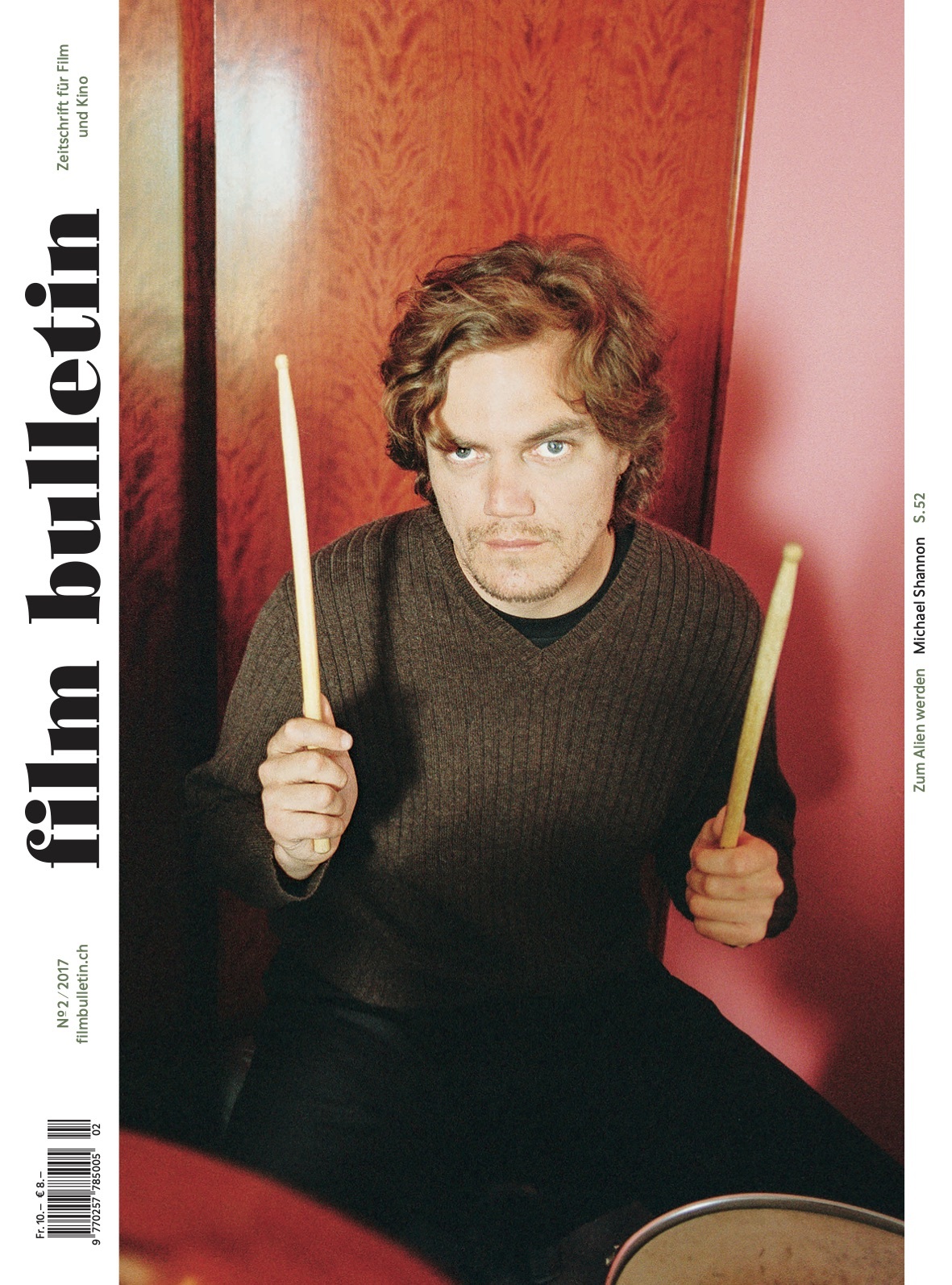Der amerikanische Ausdruck «la-la land» bezeichnet einen traumartigen, von der Realität losgelösten Gemütszustand und wird gerne spezifisch für die Stadt Los Angeles verwendet, in die all jene strömen, die von einer Karriere im Film- oder Musikbusiness träumen, dort jedoch meistens von der Realität eingeholt werden. Von eben solchen Träumern handelt Damien Chazelles zeitgemässes Filmmusical La La Land, dessen Spiel mit den Konventionen entscheidend von Justin Hurwitz’ trügerisch süffiger Musik zusammengehalten wird.
Schon in der allerersten Kamerafahrt entlang eines Verkehrsstaus sind aus den Autoradios zwischen Verdi und Hip-Hop Fetzen von Stücken aus früheren Filmen von Chazelle und Hurwitz zu hören, bevor eine locker trällernde Latina aussteigt und davon zu singen beginnt, wie sie ihren Freund verlassen hat, um ihr Glück in Hollywood zu versuchen. Anstelle einer klassischen Ouvertüre exponiert in «Another Day of Sun» nämlich ein konstant wachsender Chor aus hoffnungsvollen Einzelkämpfern die inhaltlichen Themen des Films.
Hurwitz’ dynamische Orchestrierung geht dabei immer wieder auf schauspielerische oder visuelle Details ein, etwa wenn eine Beinbewegung von der Harfe betont wird oder Klavierglissandi Kameraschwenks synchronisieren. Spätestens als sich zu Jazzcombo und Orchester eine stampfende College-Brassband gesellt, gibt der hemmungslos melodiöse Popsong mit rein sinnlicher Überwältigung jenen Intensitätsgrad vor, den die anschliessende Liebesgeschichte am Ende auf emotionaler Ebene erreichen wird.
Melancholische Heiterkeit
Im Grunde handelt La La Land von der Schwierigkeit vieler Millennials, Liebesbeziehung und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen. Für die Protagonistin Mia beispielsweise zählt einzig der Durchbruch als Schauspielerin, weshalb sie von ihren affektiert singenden Mitbewohnerinnen zwecks Networking – «someone in the crowd could be the one you need to know» – auf eine Poolparty mitgeschleppt wird. Während die Figuren hier den Tanz der Prostituierten und Neureichen aus Bob Fosses Sweet Charity (1969) parodieren, ist ihr Gesang durchwegs in der innerfilmischen Realität verankert und entwickelt sich erstaunlich organisch aus Tonlage und Rhythmus des naturalistischen Schauspiels heraus. Professionelle Sänger kommen nur in diegetischen Bühnensituationen zum Einsatz.
Als Mia sich dem wilden Treiben entzieht und vor dem Spiegel mit luftiger Stimme «is someone in the crowd the only thing you really see? / […] somewhere there’s a place where I find who I’m gonna be» singt, wirkt das auch deshalb so unerwartet intim, weil sie im Gegensatz zu ihren oberflächlichen Kolleginnen nicht nur die Lippen zum Playback bewegt, sondern tatsächlich live vor der Kamera singt. Zudem verleiht Hurwitz Mias optimistischen Solostücken immer wieder mit offenen Majorseptakkorden eine bittersüsse Note. Daran zeigt sich der allgegenwärtige Einfluss von Michel Legrand, dessen eingängige Musik zu Jacques Demys Nouvelle-Vague-Musicals Les parapluies de Cherbourg (1963) und Les demoiselles de Rochefort (1967) selbst in überschwänglichen Momenten noch melancholisch klingt. Obwohl die prominenten Vibraphon- und Holzbläserklänge stark an Legrands Easy-Listening-Jazz der Sechzigerjahre erinnern, trägt Hurwitz’ durchsichtige Partitur eine eigene Handschrift. Da taucht die Celesta reale Schauplätze in eine unwirkliche Atmosphäre, während schwerelose Flötenmotive Mias traumwandlerischen Gang durch die geräuschlos tanzenden Leute vermitteln.
Spiel mit den Konventionen
Im Anschluss an diese Party lässt sich Mia erstmals vom Jazzpianisten Sebastian verzaubern, der sich am Klavier eines Restaurants als selbstvergessener Romantiker entpuppt. Als Mia in ihm allerdings den rüden Autofahrer aus dem morgendlichen Stau erkennt, überlagert dessen charakteristische Autohupe in ihrem Kopf allmählich die Musik. Dennoch wird dieser schwelgerische Walzer bald zu «Mia & Sebastian’s Theme».
Zunächst versichern sich die beiden jedoch im swingenden «A Lovely Night», dass sie auf keinen Fall zusammenpassen. So singt Ryan Gosling entspannt zur extradiegetischen Klavierbegleitung: «some other girl and guy / would love this swirling sky», worauf Emma Stone von Flöten und Bigband-Einwürfen begleitet mit den Worten «let’s make something clear / I’ll be the one to make that call» den Tarif durchgibt, bevor die beiden in perfekter Harmonie feststellen: «what a waste of a lovely night», um sich schliesslich vielsagend zu umtanzen. Dabei folgt die Musik ihren scheinbar spontanen Bewegungen, bis der Klingelton von Mias Telefon einen sich anbahnenden Kuss verhindert. Wie ein roter Faden erinnern uns solche Störgeräusche von Smartphone, Autoschlüsseln oder Feuermelder daran, dass La La Land trotz dieser Hommage an das Balzritual von Ginger Rogers und Fred Astaire im Hier und Jetzt spielt.
Als Seb sich Mias Zuneigung endlich sicher ist, setzt er in «City of Stars» zu einem musicaltypischen inneren Monolog an, dessen Qualität vor allem in den nachdenklichen Versen der Texter Benj Pasek und Justin Paul liegt: «Is this the start of something wonderful and new? / Or one more dream that I cannot make true?» Die eintönige Melodie von «City of Stars» wird später bei einem live gesungenen Duett am heimischen Klavier um einen optimistisch aufsteigenden Mittelteil ergänzt, bevor der melancholische Schluss eine Ernüchterungsphase ankündigt. Die enttäuschten gegenseitigen Erwartungen manifestieren sich bald darauf zu einer Jazzversion von «City of Stars», mit dessen Verklingen auch die «gemeinsame» Musik definitiv verstummt.
In der Folge gelingt Mia der Durchbruch mit der persönlichen Ode «Here’s to the Fools Who Dream», in deren Verlauf Emma Stone parallel zur unauffällig einsetzenden Orchesterbegleitung allmählich das wahre Potenzial ihrer Stimme offenbart, ohne die Frustration ihrer Figur vergessen zu lassen. Auch Justin Hurwitz scheint mit dieser im Score bereits vorbereiteten Melodie musikalisch ganz bei sich selbst angekommen zu sein.
Gebrochenes Wunschdenken
Natürlich wird auch Sebastians Traum vom eigenen Jazzclub in Erfüllung gehen. Denn Chazelle, der den Jazz in seinem improvisierten Erstling Guy and Madeline on a Park Bench (2009) als Medium des persönlichen Ausdrucks und in [art:whiplash:Whiplash] (2014) als beklemmenden Machtkampf zeigte, verwendet in La La Land viel Energie darauf, dem Kinopublikum die Jazzmusik als affektives Kommunikationsmittel näherzubringen. Das ist wohl auch der Grund, warum Sebastians romantischer Walzer, der erst in den letzten Takten in eine freie Improvisation übergeht, inhaltich als Jazz verkauft wird und alle echten, ebenfalls von Hurwitz komponierten Jazznummern des Films zum Tanzen einladen.
Am Beispiel dieses Musikstils diskutiert La La Land zudem Ansätze zur Wiederbelebung marginalisierter Kunstformen, wobei der Film die populäre Weiterentwicklung von Jazzelementen in ebenso positivem Licht zeigt wie die nostalgische Leidenschaft für den «reinen» Jazz der fünfziger Jahre. Gleichzeitig wirft der Film anhand von Sebs ambivalentem Verhältnis zur Popmusik Fragen zu Erfolg und Ausverkauf der Ideale auf. So provoziert Mia den arroganten Musiker anfangs mit einer Playbackeinlage zu jenem New-Wave-Song, den sie sich von der affigen 80s-Coverband wünscht, bei der Seb mit Todesverachtung das Plastikkeyboard bedient. Als er dann in der zweiten Hälfte des Films mit einer publikumswirksamen Band ein Konzert gibt und in John Legends groovendem R&B-Song «Start a Fire» sogar ein überzeugendes Synthesizersolo hinlegt, befürchtet nun umgekehrt Mia, dass sich Seb dadurch von seinen Zielen wegbewegt.
Die Diskrepanz zwischen unserem eigenen Wunschdenken und der innerfilmischen Realität führt uns Chazelle schliesslich im finalen Traumballett vor Augen, das die enge kompositorische Verwandtschaft all der verschiedenen musikalischen Themen erkennen lässt und uns schmerzhaft daran erinnert, was die Figuren für ihren individuellen Erfolg aufgegeben haben.