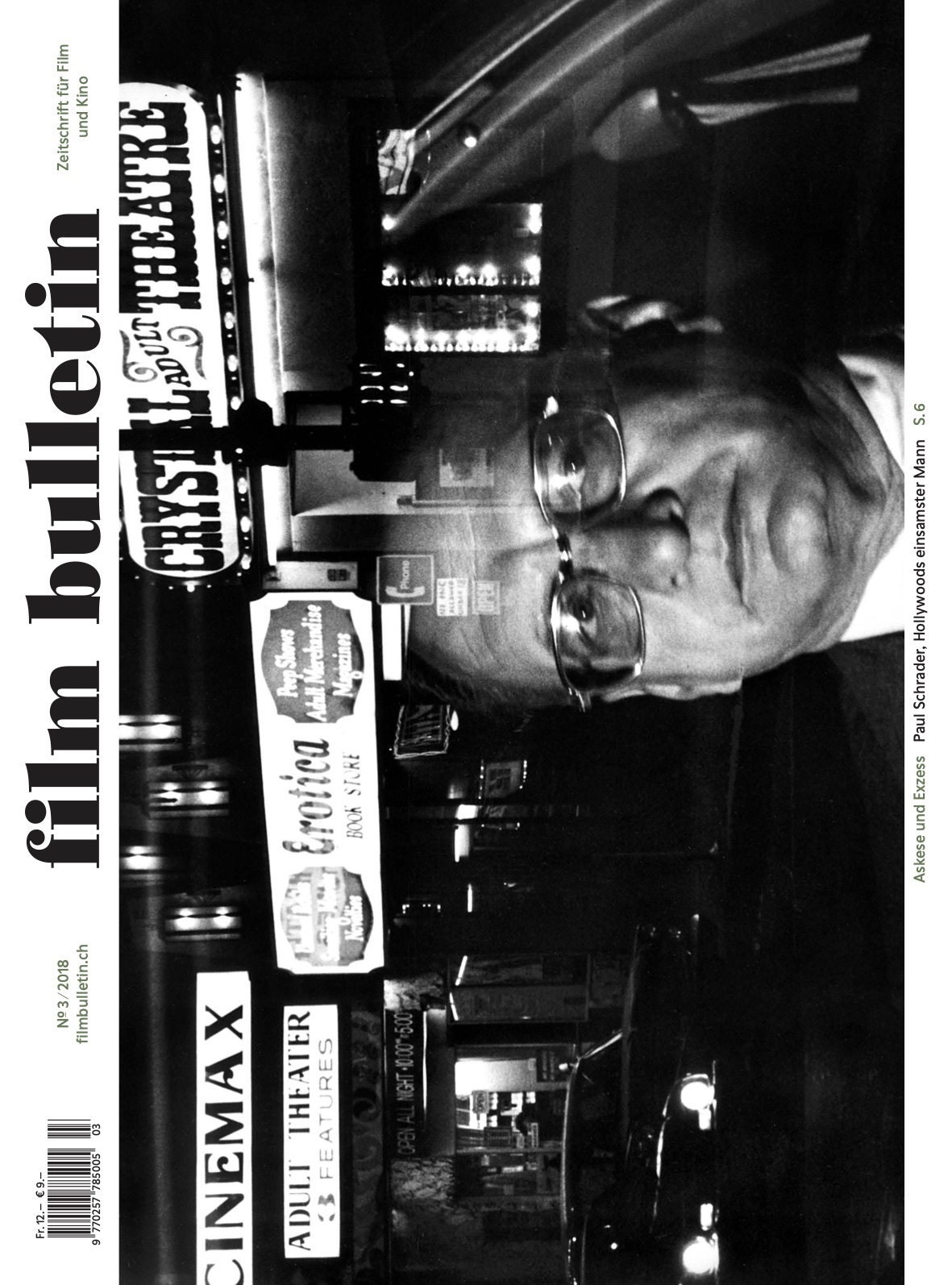Filmbulletin: Herr Swiaginzew, Familienbeziehungen und ihre Auswirkungen auf den Einzelnen spielen in Ihrem Werk eine zentrale Rolle. Was fasziniert Sie an den Dynamiken, die dabei freigesetzt werden?
Andrei Swiaginzew: Das wird Sie jetzt wahrscheinlich enttäuschen, aber ich habe keine gezielte Strategie, wenn es um die Themenwahl meiner Filme geht. Es ist eher so, dass die Geschichten auf mich zukommen. Sie klopfen einfach an meine Tür und präsentieren sich. Und sind sie erst einmal da, habe ich keine andere Wahl, als mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Was mich interessiert, ist das Innerste eines Menschen, das, was uns menschlich macht. Situationen, in denen Personen vor schwierige Aufgaben oder Entscheidungen gestellt werden. Und was meine Filme in der Hinsicht vielleicht am ehesten verbindet, ist mein persönlicher Anspruch, in jedem Fall ehrlich mit den Geschichten umzugehen und mit der Realität, die sie beschreiben.
Hatten Sie selbst eine glückliche Kindheit?
Ja, absolut. Ich hatte eine sorglose Kindheit, die sich in keinster Weise mit den Problemen in Beziehung setzen lässt, die in meinen Filmen zum Ausdruck kommen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater hat uns verlassen, als ich vier oder fünf Jahre alt war. Rückblickend betrachtet, kann es schon sein, dass wir ohne ihn ein recht einsames Leben geführt haben. Aber meine Mutter hat ihr Bestes getan, um die Vaterlücke auszugleichen, und ich habe als Kind nie das Gefühl gehabt, mir würde etwas fehlen. Ebenso wenig mache ich meinem Vater Vorwürfe, dass er uns verlassen hat. Ich glaube nicht, dass er etwas Schlimmes getan hat.
Erinnern Sie sich an Ihren Vater?
Ich erinnere mich an einen Moment, als ich siebzehn war und seit einem Jahr an der Schauspielschule in Nowosibirsk studierte. Mein Vater kam zu Besuch aus Tomsk, einer anderen Stadt in Sibirien, wo er sich nach der Trennung von meiner Mutter eine neue Familie aufgebaut hatte. Meine Eltern unterhielten sich in der Küche ohne mich, und als mein Vater ging, sah er mich nur flüchtig an und meinte: «Lass uns Hallo zueinander sagen und auf Wiedersehen.» Wir umarmten uns, und er verliess daraufhin die Wohnung. Später erzählte mir meine Mutter, wie entrüstet er darüber gewesen war, zu erfahren, dass ich Schauspieler werden wollte. «Das ist doch kein Beruf für einen Mann», sagte er. Da wurde mir schliesslich bewusst, dass seine Abwesenheit auch etwas Gutes hatte. Mein Vater hätte meinen Karriereplänen niemals zugestimmt. Meine Mutter dagegen hat mich in allem unterstützt. Sie war Lehrerin für Russisch und Literatur – sie hat mich verstanden.

Der zwölfjährige Aljoscha in [art:1345] ist ein sehr einsames Kind, das unter der Selbstsucht seiner Eltern leidet. Wie vermittelt man einem jungen Darsteller wie Matwei Nowikow, der bisher keine Filmerfahrung hat, wonach man als Regisseur in dieser Figur sucht?
Matwei hatte keine Ahnung, worum es in dem Film genau geht. Er hatte weder das Drehbuch gelesen noch einen Überblick über die Handlung erhalten. Die Schlüsselszene hinter der Tür wurde zudem so gedreht, dass er vom Gespräch der Eltern nichts mitbekam. Wir haben zeitversetzt gefilmt. Ich bat ihn darum, sich vorzustellen, wie er sich fühlen würde, wenn ihm das, was ihm am meisten auf der Welt bedeutet, genommen würde. Wenn er es für immer verlieren würde. Dann stellte er sich auf seine Position und liess – wie ein professioneller Schauspieler – das Gefühl langsam in sich aufsteigen. Irgendwann gab er uns ein kurzes Zeichen, und wir haben die Kamera laufen lassen. Ich habe ihn später nie gefragt, woran er in dem Augenblick gedacht hatte. Denn sollte er tatsächlich bei der Schauspielerei bleiben und jemals im Kopf an diesen Ort zurückkehren, dann muss es unbedingt sein Geheimnis bleiben.
Was ist Ihr Geheimnis, wenn es darum geht, die richtigen Schauspieler_innen für Ihre Filme zu finden?
Es kommt in erster Linie darauf an, den richtigen Typ Schauspieler_in zu finden. Und damit meine ich Schauspieler_innen, die von vornherein etwas in sich tragen, um mit der Figur, um die es geht, auf einer tieferen Ebene zu korrespondieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber wenn Sie erst mal die richtige Person gefunden haben, müssen Sie dem- oder derjenigen nur noch den Raum geben, diese innere Verbundenheit vor der Kamera preiszugeben. Und das Drehbuch ist in der Hinsicht ja sehr direkt. Wenn die Frau beispielsweise sagt: «Ich habe dich nie geliebt.» Dann sind das dreizehn Jahre Ehe, die mit einem Satz den Bach runtergehen. Dafür braucht man Schauspieler_innen, die den Mut und die Fähigkeit haben, in einer Situation wie dieser emotional an ihre Grenzen zu gehen.

Ihr letzter Film Leviathan, in dem eine Familie im Konflikt mit einem korrupten Bürgermeister alles verliert, sorgte für Aufruhr und Hetzkampagnen in Russland. Er wurde zunächst für die Oscars eingereicht und später vehement kritisiert, weil er, um es milde auszudrücken, nicht der von der Regierung gewünschten Agenda entsprach. Hatte das auch für Sie persönlich Konsequenzen?
Ja, zunächst schon. Die Reaktionen waren heftig. Es war viel Hass dabei, es gab Drohungen und Provokationen, sogar eine ganz konkrete, bei der jemand meine Filme verbrannte und dann ein Video ins Internet stellte mit der Meldung: «Swiaginzew ist tot!» Dazu kam, dass ein Politiker forderte, der Regisseur des Films, also ich, solle auf den Roten Platz gebracht werden, um das russische Volk öffentlich auf Knien um Vergebung zu bitten. Aber zum Glück blieb das alles recht fern von mir, weil meine Familie und meine Freunde mich bereits vor den Reaktionen gewarnt hatten und ich mich entsprechend von den Kommentaren abschottete. Auch für meine weitere Arbeit hatte das Ganze erstaunlich wenig Konsequenzen, denn bereits ein paar Monate später begann ich mit meinem neuen Projekt, mit dem einzigen Unterschied, dass wir diesmal wieder gänzlich auf staatliche Finanzierung verzichteten.
[art:1345] ist eine internationale Koproduktion.
Genau. Allerdings betrug auch bei Leviathan der Anteil der staatlichen Gelder lediglich zwanzig Prozent. Und ganz ehrlich, wir hatten wirklich nicht damit gerechnet, dass der Film eine derart heftige Reaktion hervorruft. Doch die Ereignisse von 2014, die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, das alles hat das Publikum in einer Art und Weise gespalten, wie wir es bisher in unserem Land wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Deshalb war Leviathan in dem ganzen Chaos vielleicht so etwas wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Auch in [art:1345] wird durch einen Fernsehbericht über den Ukrainekonflikt die Thematik des Films indirekt als ein gesellschaftliches Problem definiert. Warum war Ihnen das so wichtig?
Die Handlung beginnt im Oktober 2012 und endet im Februar 2015. Es ist genau die Zeit, in der in unserer Gesellschaft einige radikale Veränderungen vonstattengingen, die unser aller Leben komplett auf den Kopf stellten. Dazu kam die Problematik mit der Ukraine, die in ihrem Kern die Geschichte einer ungeheuren Niederlage ist. Das heisst, in dem Moment, in dem wir die Aggressionen und Ängste der Figuren zeigen und in diesen Zeitraum verlagern, gewinnen die zentralen Motive des Films wie Verlust, Trennung und Konfrontation noch einmal eine ganz andere Dimension. Damals 2011 hatten wir vielleicht noch eine wenn auch noch so geringe Hoffnung auf Veränderung. Heute sieht die Welt anders aus und nur noch hartnäckige Fürsprecher_innen Putins würden behaupten, dass wir in einer komfortablen Gesellschaft leben.Für alle anderen fühlt es sich eher wie in einem Minenfeld an.

Wie wichtig ist es für Sie als Regisseur, mit Ihren Figuren, seien sie auch noch so unausstehlich, zu sympathisieren?
Extrem wichtig. Ohne meine Sympathie für die Figuren würden sie zu Karikaturen verkommen. Und der ganze Film würde eher einer Satire gleichen, anstatt ein realistisches Porträt dieser Menschen nachzuzeichnen. Ausserdem verdienen sie unser Mitgefühl, egal wie monströs sie sich verhalten, denn letztlich können sie gar nicht anders. Sie sind so blind wie ein paar frisch geborene Kätzchen, die nicht verstehen, was sie da tun und warum sie es tun. In diesem Zusammenhang ist mir neulich ein Satz von David Fincher aufgefallen, den ich seitdem nicht mehr vergessen habe. In einem Interview sprach er darüber, wie wichtig es sei, die Argumente auf beiden Seiten stets gleich überzeugend zu präsentieren, weil jede Seite ihre eigene Wahrheit habe, die es zu erfahren gelte. Nur so könne man ein realistisches Bild und damit einen realistischen Film schaffen. Besser hätte ich es nicht formulieren können.
Mit Andrei Swiaginzew sprach Pamela Jahn.
Die Kritik zu [art:1345] gibt es nachzulesen hier.