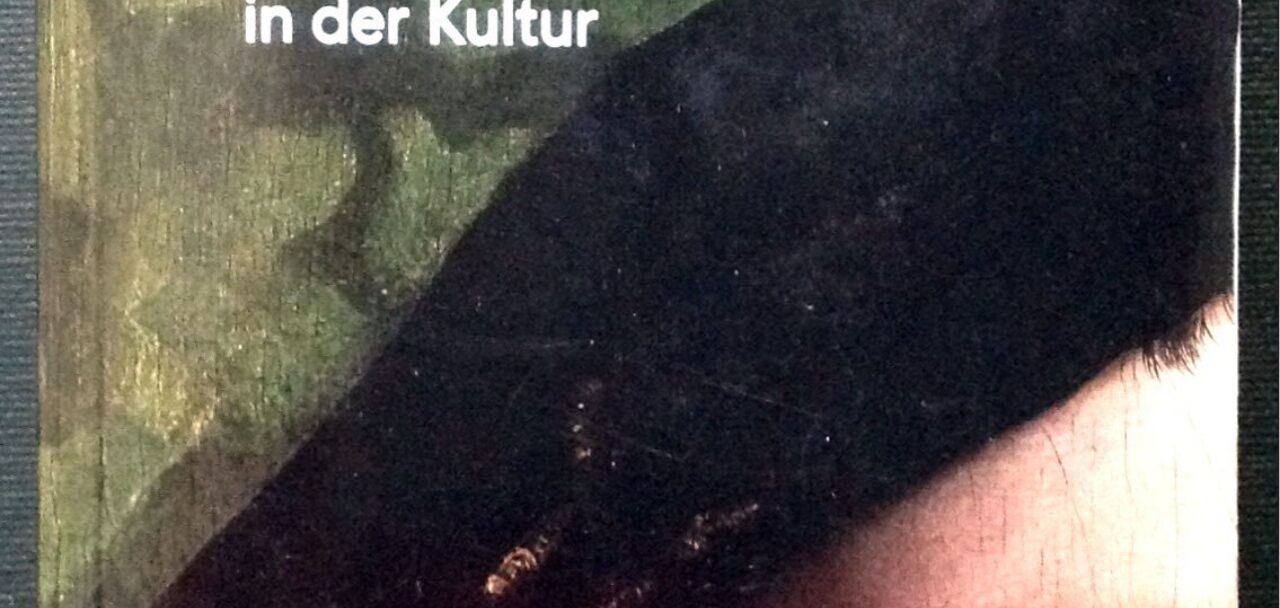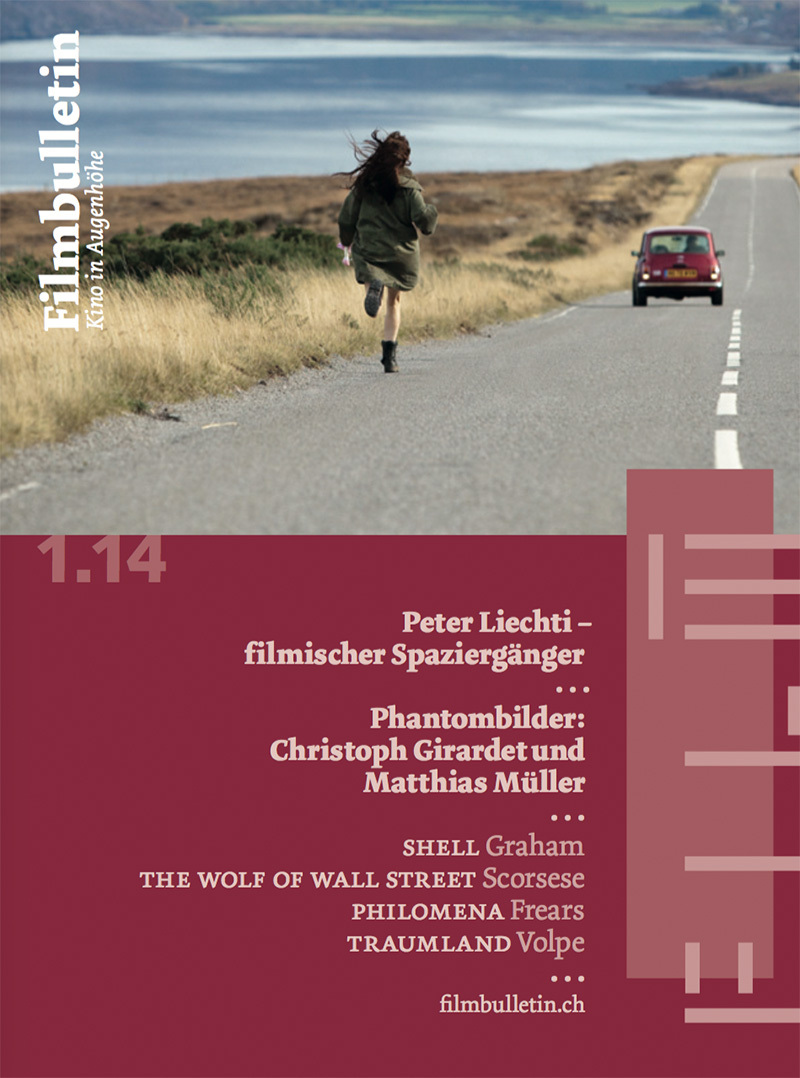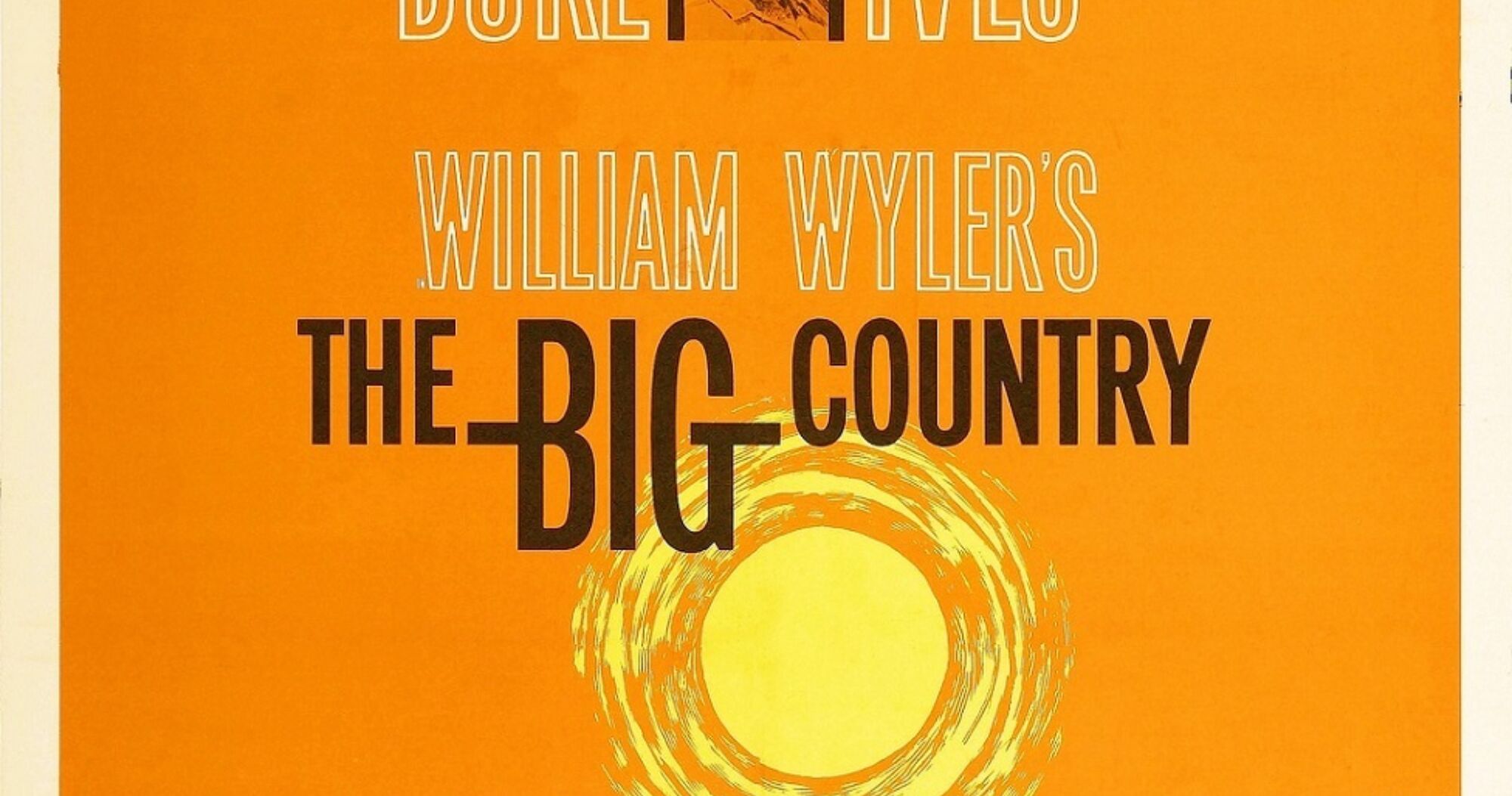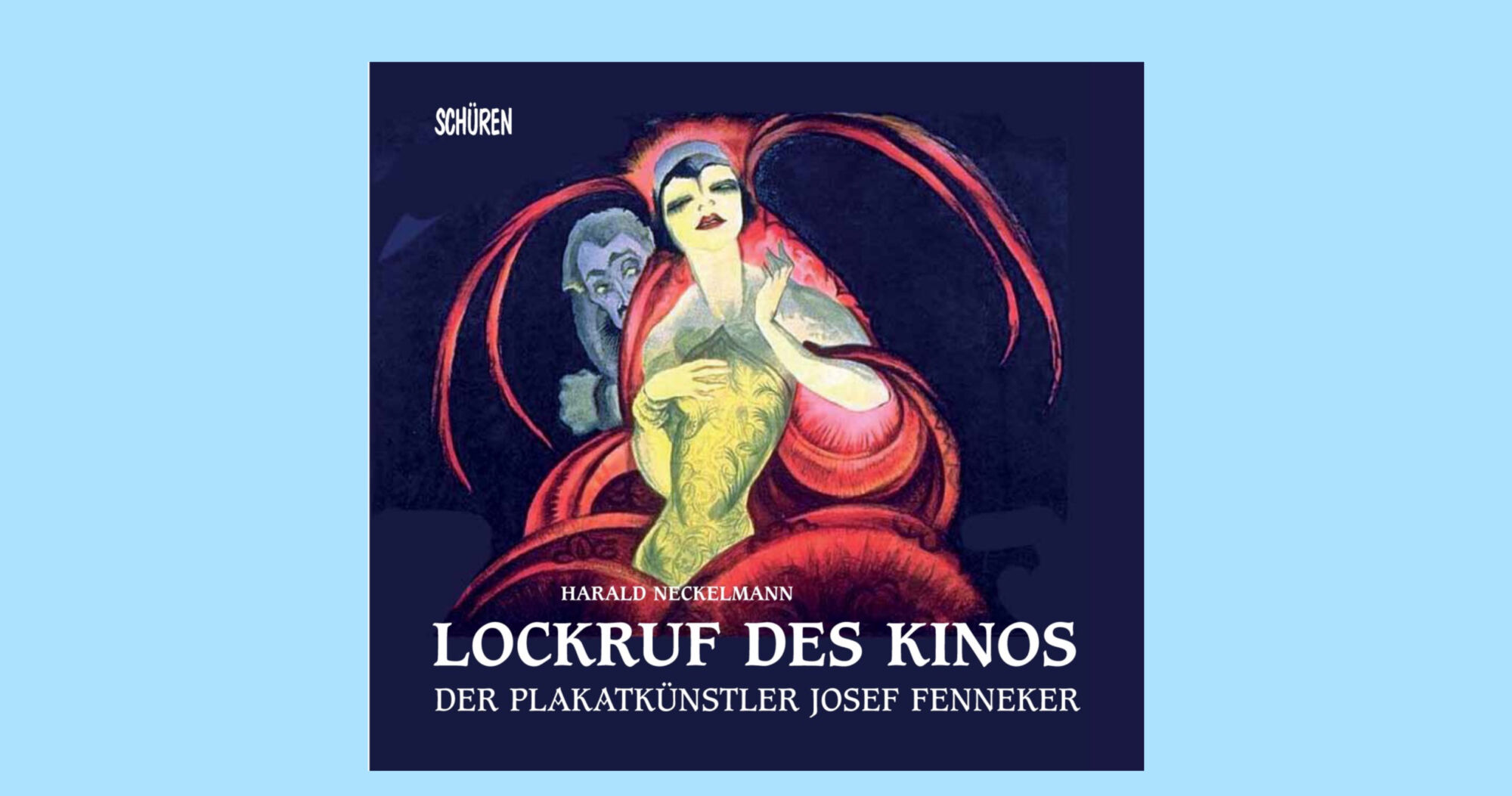Sei es eine Erscheinung am Himmel, die man sich nicht erklären kann, oder der Eindruck, das stockdunkle Zimmer, in dem man herumtappt, habe sich merkwürdigerweise ausgedehnt und einem obendrein böswillig seine Möbel in den Weg geschoben: Wir alle kennen die Erfahrung des Unheimlichen. Am häufigsten begegnet sie uns aber als künstlich induzierte, in Konfrontation mit Literatur, mit Bildwerken, mit Filmen. Es verwundert daher nicht, dass das Unheimliche, obwohl als Qualität des Erlebens zunächst von der Psychologie erforscht, zu einer so beliebten Domäne der Literaturwissenschaft und verwandter Felder wurde.
Dass sich dem Phänomen noch immer neue Perspektiven abgewinnen lassen, beweist Johannes Binotto mit seiner Dissertation «TAT/ORT. Das Unheimliche und sein Raum in der Kultur». Ausgehend von den psychoanalytischen Theorien Freuds und Lacans betrachtet der Zürcher Kulturwissenschaftler und Filmpublizist das Unheimliche für einmal nicht unter dem Aspekt von Stimmung und Gefühl, sondern als räumliches Ereignis. Anhand von sechs Werkgruppen untersucht er die mediale Konstruktion von Räumen, die «schillernde Zwischenreiche» eröffnen im Übergang von Fremdem und Vertrautem, innen und aussen, Leben und Tod.
In diesen Kunstwerken – so Binottos These – ist der Ort nicht blosse Bühne eines Geschehens, sondern wird selbst zum Täter. So etwa in Edgar Allan Poes Schauergeschichte «Ligeia», in der ein gespenstisch eingerichtetes Brautgemach nicht so sehr Ausdruck als vielmehr Ursache des in ihm waltenden Wahnsinns ist. Mehr noch, solche Werke beschreiben nicht nur welche, sie werden selber zu unheimlichen Räumen, in denen der Rezipient jede Sicherheit und Orientierung verliert: «Beim Lesen der Irrgärten in Poes Texten sind wir selbst in jene noch unheimlicheren Irrgärten getappt, die seine Texte selbst sind.» Ob er die von Poe oder Charlotte Perkins Gilman beschriebenen Räume als Metaphern für das Schreiben und Lesen von Texten deutet, nur auf dem Zeichenpapier mögliche Perspektiven in Piranesis Kupferstichen imaginärer Kerker betrachtet oder Lovecrafts «endlose Reisen durch verwesende Medienlandschaften» verfolgt, letztlich findet Binotto das Unheimliche seiner Untersuchungsgegenstände stets in deren selbstreferenziellem Charakter begründet.
Als besonders gewinnbringend erweist sich dabei die Auseinandersetzung mit dem Kino. Präzise beobachtet und pointiert formuliert, führt der Autor vor, wie Fritz Langs Filme auf das verweisen, was sie sind: ein Spiel aus Licht und Schatten, das seine Räume im Zeigen erst schafft, ständig begrenzt und bedroht von jenem «jenseitigen Bereich» ausserhalb des Bildes, dem Off. Dies ist auch der Ort, aus dem in Dario Argentos tenebre behandschuhte Mörderhände Opfer überrumpeln, von denen sie längst hätten bemerkt werden müssen. Binotto gelingt es, solch manifester Unlogik mit seiner «Topo-Logik» überraschende neue Lesarten abzugewinnen (schade nur, dass die oft kleinen, dunklen Fotos hier wenig erkennen lassen). Er errichtet einen «Denkraum» (wie es Aby Warburg nennt) aus brillanter Rhetorik, in dem der Leser sich bisweilen verirren kann, den zu begehen aber ein beachtliches intellektuelles Vergnügen ist.
Johannes Binotto: TAT/ORT. Das Unheimliche und sein Raum in der Kultur. Zürich, Berlin, Diaphanes, 2013. 304 Seiten, Fr. 40.–, € 26, 95